|
|
|
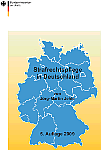 
 Diese
Publikation will ein wirklichkeitsgetreues Abbild strafbaren Verhaltens
und dessen Verfolgung anhand ausgewählter statistischer Ergebnisse
vermitteln. Darüber hinaus soll sie auch einen Einblick in unser System
der Strafrechtspflege ermöglichen. Diese
Publikation will ein wirklichkeitsgetreues Abbild strafbaren Verhaltens
und dessen Verfolgung anhand ausgewählter statistischer Ergebnisse
vermitteln. Darüber hinaus soll sie auch einen Einblick in unser System
der Strafrechtspflege ermöglichen.
 (1) (1)
Mit diesen Worten wird die Studie von Jehle über die Strafrechtspflege
in Deutschland angekündigt
 (2).
Sie verarbeitet die statistischen Daten bis einschließlich 2007 und gibt
eine Einblick in die Polizeiliche Kriminalstatistik, die Fallzahlen und
Erledigungen bei der Staatsanwaltschaft und den Gerichten und
schließlich im Justizvollzug. Die Zahlenwerke bestätigen die hohe Zahl
der Verfahrenseinstellungen bei der Staatsanwaltschaft, den
zurückhaltenden Anteil von Verurteilungen zu Freiheitsstrafen und den
deutlichen Anstieg der "einfachen" Gewaltdelikte. (2).
Sie verarbeitet die statistischen Daten bis einschließlich 2007 und gibt
eine Einblick in die Polizeiliche Kriminalstatistik, die Fallzahlen und
Erledigungen bei der Staatsanwaltschaft und den Gerichten und
schließlich im Justizvollzug. Die Zahlenwerke bestätigen die hohe Zahl
der Verfahrenseinstellungen bei der Staatsanwaltschaft, den
zurückhaltenden Anteil von Verurteilungen zu Freiheitsstrafen und den
deutlichen Anstieg der "einfachen" Gewaltdelikte.
Die Studie liefert einen Einstieg und beschreibt in einfachen Worten
die justiziellen Prozesse, die den Zahlen zugrunde liegen. Sie
unternimmt keine Bewertung und die Darstellungstiefe bleibt an der
Oberfläche.
Der Wert der Studie besteht darin, dass sie die Strafverfolgung über
alle vier Instanzen hinweg darstellt und dadurch die Arbeitsteilung
zwischen Polizei, Justiz und Justizvollzug betrachtet. Ihr fehlt jedoch
ein abschließender vergleichender Teil, der die Deliktsgruppen durch die
Instanzen hindurch betrachtet.
|
 Einen
liebevollen Einblick in das Innenleben der Einen
liebevollen Einblick in das Innenleben der
 wirft Kleinz in der wirft Kleinz in der

 (3).
Leichte Kost, aber gut lesbar, informativ und zurückhaltend (3).
Leichte Kost, aber gut lesbar, informativ und zurückhaltend
 (4). (4).
 Die
Wikipedia ist eine Enzyklopädie, sie liefert Allgemein- und
Alltagswissen und ist kein Spezialportal für ganz besondere Themen.
Diese Aufgabe erfüllt sie gut und sie ersetzt damit die
20-bändigen Taschenbuchausgaben, mit denen ich aufgewachsen bin. Mit
ihrer Präsenz hilft sie zum Beispiel dem Cyberfahnder, keine übermäßigen
Erklärungen ausführen zu müssen; wegen der technischen Grundlagen,
Erklärungen und Umfelder reicht in aller Regel ein Verweis auf sie, so
dass ich mich - und den Leser - auf das Wesentliche konzentrieren kann. Die
Wikipedia ist eine Enzyklopädie, sie liefert Allgemein- und
Alltagswissen und ist kein Spezialportal für ganz besondere Themen.
Diese Aufgabe erfüllt sie gut und sie ersetzt damit die
20-bändigen Taschenbuchausgaben, mit denen ich aufgewachsen bin. Mit
ihrer Präsenz hilft sie zum Beispiel dem Cyberfahnder, keine übermäßigen
Erklärungen ausführen zu müssen; wegen der technischen Grundlagen,
Erklärungen und Umfelder reicht in aller Regel ein Verweis auf sie, so
dass ich mich - und den Leser - auf das Wesentliche konzentrieren kann.
 Nie müde
wird der Vorwurf, eine Quelle sei nicht zitierfähig. Das ist schon vom
Ansatz her Unfug: Jede Quelle ist zitierfähig! Der Autor muss nur wissen
und darlegen, was er mit einer Quelle belegen will. Auch mit abstrusen
Meinungen und Falschmeldungen kann man sich auseinandersetzen, so dass
auch sie im Einzelfall eine relevante Quelle sein können. Nie müde
wird der Vorwurf, eine Quelle sei nicht zitierfähig. Das ist schon vom
Ansatz her Unfug: Jede Quelle ist zitierfähig! Der Autor muss nur wissen
und darlegen, was er mit einer Quelle belegen will. Auch mit abstrusen
Meinungen und Falschmeldungen kann man sich auseinandersetzen, so dass
auch sie im Einzelfall eine relevante Quelle sein können.
Die Wikipedia ist als das zu nehmen, was sie sein will: Ein Lexikon und
damit eine Wissenssammlung ohne die Ambition, die wissenschaftliche
Forschung oder die journalistische Meinungsbildung zu neuen Ufern zu
entwickeln.
Streicht man die Flausen weg, so macht sie ihre Sache wirklich gut.
|
|
|
|
 15.11.2009: Die Relevanzdiskussion hat sich ausgebreitet und ich
verzichte auf Belege, die nichts bringen.
15.11.2009: Die Relevanzdiskussion hat sich ausgebreitet und ich
verzichte auf Belege, die nichts bringen.
Vielleicht hilft ein Gedanke: Ein Lexikon kann verschiedene Ansprüche
an sich erheben. Will es Begriffe und Bedeutungen erklären, so ist es
eher ein Wörterbuch. Wenn es hingegen eine vertiefte Auseinandersetzung
liefern will, dann sind Qualitätsfragen und strenge Kontrollen
notwendig.
Warum jedoch soll die
 nicht
beides liefern? Als Wörterbuch und Einstieg in ein Thema ist sie bereits
gut geeignet. Ihr fehlen bislang die Links zu den vertiefenden Quellen
und die detaillierte Auseinandersetzung mit den Themen. nicht
beides liefern? Als Wörterbuch und Einstieg in ein Thema ist sie bereits
gut geeignet. Ihr fehlen bislang die Links zu den vertiefenden Quellen
und die detaillierte Auseinandersetzung mit den Themen.
Sinnvoll erscheint es mir, Wörterbuch und "großes" Lexikon
miteinander zu verbinden. Den Einstieg könnte das  -Portal
liefern, das als Wörterbuch nur den Begriff erklärt. Die Hintergründe,
Zweifel und Kontroversen könnte die echte -Portal
liefern, das als Wörterbuch nur den Begriff erklärt. Die Hintergründe,
Zweifel und Kontroversen könnte die echte
 -Enzyklopädie
liefern. Sie wäre die Plattform für die Auseinandersetzung über die
Relevanz von Themen. -Enzyklopädie
liefern. Sie wäre die Plattform für die Auseinandersetzung über die
Relevanz von Themen.
|
 Von einem
Protagonisten der Boulevardpresse ist die werbewirksame Forderung
bekannt: Fakten, Fakten, Fakten. Von einem
Protagonisten der Boulevardpresse ist die werbewirksame Forderung
bekannt: Fakten, Fakten, Fakten.
Dem stimme ich zu.
Auf die
 bezogen
bedeutet das aber, dass zunächst die Begriffsklärung nötig ist und in
der weiteren Tiefe die Auseinandersetzung mit ihm erfolgt. bezogen
bedeutet das aber, dass zunächst die Begriffsklärung nötig ist und in
der weiteren Tiefe die Auseinandersetzung mit ihm erfolgt.
Die Qualitätskontrolle für die Begriffsklärung dürfte verhältnismäßig
einfach sein. Wenn es um die vertiefenden Auseinandersetzungen geht,
muss Freiheit im Spiel bleiben. Erst wenn es um die Rückübertragung zum
Wörterbuch geht, sind strenge Qualitätskriterien gefragt.
 Das Löschen
ist die schlechteste Option. Sie verweigert die Auseinandersetzung.
Nötig ist der Diskurs, an dessen Ende die Übereinkunft steht. Das Löschen
ist die schlechteste Option. Sie verweigert die Auseinandersetzung.
Nötig ist der Diskurs, an dessen Ende die Übereinkunft steht.
|

