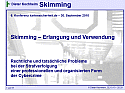|
 Danach ist ein Versuch des gewerbs- und bandenmäßigen Nachmachens
von Zahlungskarten mit Garantiefunktion erst dann gegeben, wenn die
Täter vorsätzlich und in der tat-bestandsmäßigen Absicht mit der
Fälschungshandlung selbst beginnen (...). Zum Versuch des Nachmachens
setzt daher ... noch nicht an, wer die aufgezeichneten Datensätze noch
nicht in seinen Besitz bringen und sie deshalb auch nicht an seine
Mittäter, die die Herstellung der Kartendubletten vornehmen sollten,
übermitteln konnte.
Danach ist ein Versuch des gewerbs- und bandenmäßigen Nachmachens
von Zahlungskarten mit Garantiefunktion erst dann gegeben, wenn die
Täter vorsätzlich und in der tat-bestandsmäßigen Absicht mit der
Fälschungshandlung selbst beginnen (...). Zum Versuch des Nachmachens
setzt daher ... noch nicht an, wer die aufgezeichneten Datensätze noch
nicht in seinen Besitz bringen und sie deshalb auch nicht an seine
Mittäter, die die Herstellung der Kartendubletten vornehmen sollten,
übermitteln konnte.
 (1) (1) |
|
 Mit dem
jetzt veröffentlichten Beschluss hat der BGH zum Standardfall des
Skimmings Stellung genommen Mit dem
jetzt veröffentlichten Beschluss hat der BGH zum Standardfall des
Skimmings Stellung genommen
 (1).
Der Täter wurde offenbar gefasst, nachdem er die Ausspähgeräte
installiert hatte. Sie wurden jedoch entdeckt und abgebaut, so dass das
Ausspähen erfolglos blieb. (1).
Der Täter wurde offenbar gefasst, nachdem er die Ausspähgeräte
installiert hatte. Sie wurden jedoch entdeckt und abgebaut, so dass das
Ausspähen erfolglos blieb.
Das Landgericht Dresden hatte, so wie ich es früher auch vertreten
habe, bereits im Ausspähen den Beginn des Versuchs des Fälschens von
Zahlungskarten gesehen. Für mich ist dafür ausschlaggebend gewesen, dass
das Ausspähen der Magnetkartendaten eine notwendige Voraussetzung für
die anschließende Fälschung ist.
Der BGH folgt nun aber - nicht unvorhersehbar - der strengen
Auslegung und lässt den Versuch erst dann beginnen, wenn in einer
arbeitsteiligen Organisation die ausgespähten Daten in die Hand des
Fälschers gegeben werden.
An dieser Stelle bleibt ein Rest an Unklarheit, wenn es um die Frage
geht, ob für den Skimmer (Ausspäher) der Versuch des Fälschens bereits beginnt,
wenn er in einer arbeitsteiligen Struktur die ausgespähten Daten an den
Fälscher übermittelt. Die Wortwahl des BGH scheint dies anzudeuten.
Damit ginge der BGH sehr weit. Die Übergabe der Daten erfüllt noch
kein Tatbestandsmerkmal des Fälschens gemäß
 § 152b Abs. 1 StGB. Für den arbeitsteilig handelnden Skimmer endet
damit jedoch sein Tatbeitrag und seine Tatherrschaft. Dennoch passt
diese Auslegung in die Entscheidungslinie des BGH, dass der Versuch
nicht zwingend mit der Erfüllung eines Tatbestandsmerkmals beginnen
muss, sondern bereits dann, wenn nach der inneren Vorstellung des Täters
seine Tathandlung unmittelbar in die Tatvollendung mündet: "Jetzt geht
es los!"
§ 152b Abs. 1 StGB. Für den arbeitsteilig handelnden Skimmer endet
damit jedoch sein Tatbeitrag und seine Tatherrschaft. Dennoch passt
diese Auslegung in die Entscheidungslinie des BGH, dass der Versuch
nicht zwingend mit der Erfüllung eines Tatbestandsmerkmals beginnen
muss, sondern bereits dann, wenn nach der inneren Vorstellung des Täters
seine Tathandlung unmittelbar in die Tatvollendung mündet: "Jetzt geht
es los!"
|
  Entsprechend des Beschlusses vom 14.09.2010 wurde das
Entsprechend des Beschlusses vom 14.09.2010 wurde das
 Arbeitspapier
Skimming
aktualisiert und (ausnahmsweise) etwas gekürzt. Es umfasst jetzt 50 Seiten. Arbeitspapier
Skimming
aktualisiert und (ausnahmsweise) etwas gekürzt. Es umfasst jetzt 50 Seiten.
|
|
|
 Ungeachtet
dieser Klarstellung enthält der Beschluss weitere Bonbons: Ungeachtet
dieser Klarstellung enthält der Beschluss weitere Bonbons:
 Der BGH unterscheidet mit keinem Wort zwischen Kredit- und Debitkarten.
Das bedeutet, dass beide Kartenarten jedenfalls dann Zahlungskarten mit
Garantiefunktion sind, wenn sie am bargeldlosen Zahlungsverkehr
teilnehmen können.
Der BGH unterscheidet mit keinem Wort zwischen Kredit- und Debitkarten.
Das bedeutet, dass beide Kartenarten jedenfalls dann Zahlungskarten mit
Garantiefunktion sind, wenn sie am bargeldlosen Zahlungsverkehr
teilnehmen können.
 Das Cashing ist als der Gebrauch gefälschter Zahlungskarten mit
Garantiefunktion in Tateinheit mit Computerbetrug zu qualifizieren. In
einer arbeitsteiligen Organisation ist der Skimmer als Mittäter am
erfolgreichen Cashing zu behandeln. Somit unterliegt er einer
Strafdrohung von mindestens 1 Jahr Freiheitsstrafe gemäß
Das Cashing ist als der Gebrauch gefälschter Zahlungskarten mit
Garantiefunktion in Tateinheit mit Computerbetrug zu qualifizieren. In
einer arbeitsteiligen Organisation ist der Skimmer als Mittäter am
erfolgreichen Cashing zu behandeln. Somit unterliegt er einer
Strafdrohung von mindestens 1 Jahr Freiheitsstrafe gemäß
 § 152b Abs. 1 StGB.
§ 152b Abs. 1 StGB.
 In den Fällen, in denen das LG Dresden den Täter wegen Versuchs des
Fälschens verurteilt hat, hat der BGH den Schuldspruch nicht aufgehoben,
sondern abgeändert. Insoweit ist der Täter einer Verbrechensabrede zum
Fälschen von Zahlungskarten mit Garantiefunktion in Tateinheit mit
gewerbs- und bandenmäßigem Computerbetrug schuldig gesprochen worden (
In den Fällen, in denen das LG Dresden den Täter wegen Versuchs des
Fälschens verurteilt hat, hat der BGH den Schuldspruch nicht aufgehoben,
sondern abgeändert. Insoweit ist der Täter einer Verbrechensabrede zum
Fälschen von Zahlungskarten mit Garantiefunktion in Tateinheit mit
gewerbs- und bandenmäßigem Computerbetrug schuldig gesprochen worden ( §§ 30 Abs. 2,
§§ 30 Abs. 2,
 152b Abs. 2,
152b Abs. 2,
 263a Abs. 2,
263a Abs. 2,
 263 Abs. 5 StGB). Der Computerbetrug ist dann ein (qualifiziertes)
Verbrechen, wenn der Täter gewerbsmäßig und als Teilnehmer einer Bande
handelt. Diese Voraussetzungen müssen im einzelnen festgestellt werden.
263 Abs. 5 StGB). Der Computerbetrug ist dann ein (qualifiziertes)
Verbrechen, wenn der Täter gewerbsmäßig und als Teilnehmer einer Bande
handelt. Diese Voraussetzungen müssen im einzelnen festgestellt werden.
|
|