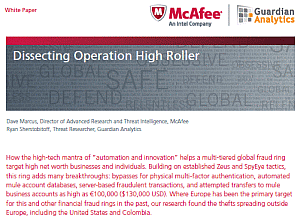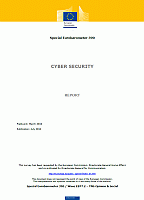|
|
Schlaglichter
 Am
26.06.2012 ist das Am
26.06.2012 ist das
 Gesetz zur Stärkung der Pressefreiheit im Straf- und Strafprozessrecht -
PrStG veröffentlicht worden, das am 01.08.2012 in Kraft tritt. Es sieht Änderungen in
Gesetz zur Stärkung der Pressefreiheit im Straf- und Strafprozessrecht -
PrStG veröffentlicht worden, das am 01.08.2012 in Kraft tritt. Es sieht Änderungen in
 §
353b StGB und in §
353b StGB und in
 § 97
StPO vor. Eingeschränkt wird die Strafbarkeit von bestimmten
Pressevertretern, wenn diese Geheimnisse veröffentlichen. Außerdem ist
künftig nicht nur ein einfacher, sondern ein dringender Tatverdacht
einer Beteiligung für eine Beschlagnahme bei dieser Personengruppe
erforderlich. § 97
StPO vor. Eingeschränkt wird die Strafbarkeit von bestimmten
Pressevertretern, wenn diese Geheimnisse veröffentlichen. Außerdem ist
künftig nicht nur ein einfacher, sondern ein dringender Tatverdacht
einer Beteiligung für eine Beschlagnahme bei dieser Personengruppe
erforderlich.
 Über
den Sinn der Reform kann man streiten. Über den Sinn von Formulierungen
erst recht. Der "dringende
Tatverdacht" gilt bislang nur für die Tatsachen, die die
Untersuchungshaft begründen. Er ist unterschiedlich stark je nach dem,
wie weit das Ermittlungsverfahren fortgeschritten ist. Ein "angereicherter"
Anfangsverdacht nach dem Vorbild des Über
den Sinn der Reform kann man streiten. Über den Sinn von Formulierungen
erst recht. Der "dringende
Tatverdacht" gilt bislang nur für die Tatsachen, die die
Untersuchungshaft begründen. Er ist unterschiedlich stark je nach dem,
wie weit das Ermittlungsverfahren fortgeschritten ist. Ein "angereicherter"
Anfangsverdacht nach dem Vorbild des
 §
100a StPO wäre vielleicht sinnvoller gewesen. §
100a StPO wäre vielleicht sinnvoller gewesen.
|
|
|
|
|
|
|
 
 BGH:
Filehoster haften unter Umständen für Rechtsverletzungen, Heise
online 12.07.2012 BGH:
Filehoster haften unter Umständen für Rechtsverletzungen, Heise
online 12.07.2012
Der BGH verfeinert zunehmend die Struktur des zivilen Internetrechts.
Das Signal dieser Entscheidung ist, dass sich die Hostprovider nicht
vollständig aus der Verantwortung stehlen können, aber auch nicht alle
Ferkeleien ihrer Kunden aufspüren und unterbinden müssen. Erst wenn es
konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße gibt, muss auch der Hoster handeln.
Das steht aber auch schon im Gesetz ( § 10 TMG).
§ 10 TMG).
|
|
|
|
|
|
 Mit
Spracherkennungsprogrammen auf Smartphones können Stimmenprofile
erstellt und Personen identifiziert werden: Mit
Spracherkennungsprogrammen auf Smartphones können Stimmenprofile
erstellt und Personen identifiziert werden:
 Jedes
gesprochene Wort wird auf den Servern von Apple für unbestimmte Zeit
gespeichert. Forscher mahnen nun, dass diese Aufzeichungen Stimmprofile
ermöglichen, die Strafverfolgern und Hackern zur biometrischen
Identifizierung einer Person verhelfen. Jedes
gesprochene Wort wird auf den Servern von Apple für unbestimmte Zeit
gespeichert. Forscher mahnen nun, dass diese Aufzeichungen Stimmprofile
ermöglichen, die Strafverfolgern und Hackern zur biometrischen
Identifizierung einer Person verhelfen.

 David Talbot, Siris großer Bruder, Technology
Review 10.07.2012
David Talbot, Siris großer Bruder, Technology
Review 10.07.2012
 Die französische Behörde für Atomlager - ANDRA - hat für 25.000 € den Protyp
eines Datenträgers entwickeln lassen, der mindestens 1 Mio. Jahre
überdauern soll. Die französische Behörde für Atomlager - ANDRA - hat für 25.000 € den Protyp
eines Datenträgers entwickeln lassen, der mindestens 1 Mio. Jahre
überdauern soll.
 Das Basismaterial des Datenträgers ist Saphir. Mit Platin werden die
Informationen in das Mineral eingebettet. Er soll Informationen
über atomare Lagerstätten
Das Basismaterial des Datenträgers ist Saphir. Mit Platin werden die
Informationen in das Mineral eingebettet. Er soll Informationen
über atomare Lagerstätten
 für die
Archäologen zukünftiger Generationen ... hinterlassen, die sich über
solche Beipackzettel sicherlich freuen werden: ... fragen Sie ihren Arzt
oder Apotheker!
für die
Archäologen zukünftiger Generationen ... hinterlassen, die sich über
solche Beipackzettel sicherlich freuen werden: ... fragen Sie ihren Arzt
oder Apotheker!
 Christian Kahle, Neuer Datenträger soll eine Million
Jahre halten, WinFuture 13.07.2012
Christian Kahle, Neuer Datenträger soll eine Million
Jahre halten, WinFuture 13.07.2012
|
|
|
|
|
|
 Wissenschaft ist die organisierte
Wissenschaft ist die organisierte
 Produktion von Wissen, welches das Potenzial birgt, Probleme zu
lösen und die dazu nötigen Handlungen gedanklich vorwegzunehmen,
sagt der Leiter des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte in
Berlin, Professor Jürgen Renn. Er sieht einen gemeinsamen Ursprung in
allen Disziplinen der Natur- und Geisteswissenschaften, der schon immer
darauf gerichtet war, die Welt und ihre Mechanismen zu begreifen, um sie
für eigene Zwecke zu nutzen. Noch vor wenigen Jahrhunderten unterschied
die Naturphilosophie noch nicht streng zwischen Mathematik, Physik und
Medizin.
Produktion von Wissen, welches das Potenzial birgt, Probleme zu
lösen und die dazu nötigen Handlungen gedanklich vorwegzunehmen,
sagt der Leiter des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte in
Berlin, Professor Jürgen Renn. Er sieht einen gemeinsamen Ursprung in
allen Disziplinen der Natur- und Geisteswissenschaften, der schon immer
darauf gerichtet war, die Welt und ihre Mechanismen zu begreifen, um sie
für eigene Zwecke zu nutzen. Noch vor wenigen Jahrhunderten unterschied
die Naturphilosophie noch nicht streng zwischen Mathematik, Physik und
Medizin.

 Udo
Flohr, "Alle Wissenschaften haben einen gemeinsamen
Ursprung", Technology Review 13.07.2012 Udo
Flohr, "Alle Wissenschaften haben einen gemeinsamen
Ursprung", Technology Review 13.07.2012 |
|
|
|
|
|
 Den
wesentlichen Teil dieses Nachrichtenüberblicks macht die
Auseinandersetzung mit der Den
wesentlichen Teil dieses Nachrichtenüberblicks macht die
Auseinandersetzung mit der
 Operation High Roller und der damit verbundenen Frage aus, ob
Unternehmen wie McAfee oder Symantec die Gefahren der Cybercrime nur
deshalb übertreiben, um ihre Umsätze zu fördern. Verlässliches
Zahlenwerk gibt es nicht. Die jüngste Studie von McAfee zeigt
qualitative Änderungen in der Strategie der Kriminellen, die aufhorchen
lassen.
Operation High Roller und der damit verbundenen Frage aus, ob
Unternehmen wie McAfee oder Symantec die Gefahren der Cybercrime nur
deshalb übertreiben, um ihre Umsätze zu fördern. Verlässliches
Zahlenwerk gibt es nicht. Die jüngste Studie von McAfee zeigt
qualitative Änderungen in der Strategie der Kriminellen, die aufhorchen
lassen.
 Wer es
praktischer mag, schätzt vielleicht diese Lebenshilfe: Wer es
praktischer mag, schätzt vielleicht diese Lebenshilfe:
 Die
wichtigsten Datei-Endungen im Überblick, Computerwoche 01.06.2012 Die
wichtigsten Datei-Endungen im Überblick, Computerwoche 01.06.2012
|



 |
Operation High Roller |
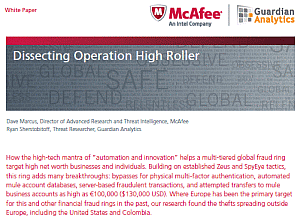
Cover |
Werden die Gefahren der Cybercrime übertrieben?
 Schumann
zweifelt im Tagesspiegel Schumann
zweifelt im Tagesspiegel
 (1)
an einem Bericht über eine groß angelegte kriminelle Aktion, die der
Antiviren-Hersteller McAfee zusammen mit dem Sicherheitsunternehmen
Guardian Analytics Ende Juni 2012 veröffentlicht hat (1)
an einem Bericht über eine groß angelegte kriminelle Aktion, die der
Antiviren-Hersteller McAfee zusammen mit dem Sicherheitsunternehmen
Guardian Analytics Ende Juni 2012 veröffentlicht hat
 (2).
Sie haben behauptet, einem internationalen Betrüger-Ring auf die
Schliche gekommen zu sein, der sich darauf spezialisiert habe,
wohlhabene Unternehmen und Privatpersonen gezielt auszuforschen, mit
Homebanking-Malware anzugreifen und jeweils bis zu 100.000 € abzugreifen. (2).
Sie haben behauptet, einem internationalen Betrüger-Ring auf die
Schliche gekommen zu sein, der sich darauf spezialisiert habe,
wohlhabene Unternehmen und Privatpersonen gezielt auszuforschen, mit
Homebanking-Malware anzugreifen und jeweils bis zu 100.000 € abzugreifen.
 Mit ihrer „Operation High Roller“, wie McAfee den Plot werbewirksam
taufte, habe die Bande seit Beginn des Jahres „versucht“, mindestens 60
Millionen Euro bei Kunden von Banken aller Größen zu erbeuten.
Mit ihrer „Operation High Roller“, wie McAfee den Plot werbewirksam
taufte, habe die Bande seit Beginn des Jahres „versucht“, mindestens 60
Millionen Euro bei Kunden von Banken aller Größen zu erbeuten.
 Heise hatte
dazu berichtet Heise hatte
dazu berichtet
 (3): (3):
 Laut McAfee nutzten die Täter ... angepasste Versionen der ...
bekannten Online-Banking-Trojaner ZeuS und SpyEye. ... Die Gauner haben
unter anderem durch Recherchen im Netz herausgefunden, bei welchem
Bankinstitut das ausgesuchte Opfer Kunde ist, um ihm anschließend den
Link zu einer speziell präparierten Webseite zu schicken, die die
Infektion vornahm.
Laut McAfee nutzten die Täter ... angepasste Versionen der ...
bekannten Online-Banking-Trojaner ZeuS und SpyEye. ... Die Gauner haben
unter anderem durch Recherchen im Netz herausgefunden, bei welchem
Bankinstitut das ausgesuchte Opfer Kunde ist, um ihm anschließend den
Link zu einer speziell präparierten Webseite zu schicken, die die
Infektion vornahm.
 ... Wenn sich das Opfer mit dem infizierten System beim
Online-Banking eingeloggt hat, wurde zunächst einmal als
Man-in-the-Browser die finanzielle Situation ausspioniert. Erst beim
nächsten Login wurde der Schädling aktiv: In der Regel hat die Malware
vollautomatisch einen festen Prozentsatz (etwa 10 Prozent) von dem Konto
mit dem höchsten Guthaben auf das Konto eines Finanzagenten transferiert.
In Einzelfällen sollen die Betrüger auch manuell eingegriffen haben, um
höhere Summen abzubuchen.
... Wenn sich das Opfer mit dem infizierten System beim
Online-Banking eingeloggt hat, wurde zunächst einmal als
Man-in-the-Browser die finanzielle Situation ausspioniert. Erst beim
nächsten Login wurde der Schädling aktiv: In der Regel hat die Malware
vollautomatisch einen festen Prozentsatz (etwa 10 Prozent) von dem Konto
mit dem höchsten Guthaben auf das Konto eines Finanzagenten transferiert.
In Einzelfällen sollen die Betrüger auch manuell eingegriffen haben, um
höhere Summen abzubuchen.
 Damit das Opfer nichts von den betrügerischen Aktivitäten merkt, hat
der Schädling die Abbuchung von der Transaktionsliste ausgeblendet und
sämtliche Links zu online ausdruckbaren Kontoauszügen entfernt.
Damit das Opfer nichts von den betrügerischen Aktivitäten merkt, hat
der Schädling die Abbuchung von der Transaktionsliste ausgeblendet und
sämtliche Links zu online ausdruckbaren Kontoauszügen entfernt.
 Der Text
von Der Text
von
 ist deshalb beachtlich, weil er genau schildert, wie die moderne
Onlinebanking-Malware funktioniert: Vollautomatisch und mit der Option,
manuell einzugreifen. Dennoch zeigt die Op High Roller Besonderheiten:
Sie konzentriert sich auf bestimmte Personen, deren Bankverbindungen
zunächst recherchiert werden. Dann folgt ein persönlicher
Spear-Phishing-Angriff, um die Zielpersonen auf eine für sie präparierte
Webseite zu locken. Bevor die Täter tatsächlich zuschlagen,
protokollieren sie zunächst eine Sitzung und erforschen vor Allem den
Kontostand. Allein in Deutschland sollen die Täter versucht haben, 1
Mio. € zu erbeuten.
ist deshalb beachtlich, weil er genau schildert, wie die moderne
Onlinebanking-Malware funktioniert: Vollautomatisch und mit der Option,
manuell einzugreifen. Dennoch zeigt die Op High Roller Besonderheiten:
Sie konzentriert sich auf bestimmte Personen, deren Bankverbindungen
zunächst recherchiert werden. Dann folgt ein persönlicher
Spear-Phishing-Angriff, um die Zielpersonen auf eine für sie präparierte
Webseite zu locken. Bevor die Täter tatsächlich zuschlagen,
protokollieren sie zunächst eine Sitzung und erforschen vor Allem den
Kontostand. Allein in Deutschland sollen die Täter versucht haben, 1
Mio. € zu erbeuten.
 Schumanns
Skepsis ist aber nicht von der Hand zu weisen. Warum hat davon keiner
was gemerkt? Schumanns
Skepsis ist aber nicht von der Hand zu weisen. Warum hat davon keiner
was gemerkt?
 Dem Bundeskriminalamt ... ist „der Sachverhalt“ jedenfalls nur „aus
der Medienberichterstattung bekannt“, sagte eine Sprecherin. Er
vermutet eine reine Angstmacherei mit dem Ziel, die Umsätze zu erhöhen.
Dem Bundeskriminalamt ... ist „der Sachverhalt“ jedenfalls nur „aus
der Medienberichterstattung bekannt“, sagte eine Sprecherin. Er
vermutet eine reine Angstmacherei mit dem Ziel, die Umsätze zu erhöhen.
|
|
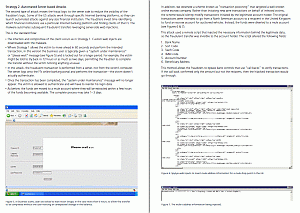
Seite 12, 13
|
 Dass
McAfee mit seinen Berichten auch in eigener Sache die Werbetrommel rührt,
ist verständlich. Ändert das etwas an der Bedeutung der Operation?
Immerhin präsentiert der Bericht Screenshots, Quellcodes und
anschauliche Karten für die Angriffsmittel und Serverstandorte. Ross und
Reiter nennt der Bericht nicht und das ist auch nicht zu erwarten, wenn
die polizeilichen Ermittlungen erst noch laufen (wie ich vermute). Dass
McAfee mit seinen Berichten auch in eigener Sache die Werbetrommel rührt,
ist verständlich. Ändert das etwas an der Bedeutung der Operation?
Immerhin präsentiert der Bericht Screenshots, Quellcodes und
anschauliche Karten für die Angriffsmittel und Serverstandorte. Ross und
Reiter nennt der Bericht nicht und das ist auch nicht zu erwarten, wenn
die polizeilichen Ermittlungen erst noch laufen (wie ich vermute).
 Schumann
hat einen Aufhänger gesucht, gefunden und geht etwas unfair mit dem
Bericht von McAfee um. Geärgert hat er sich offenbar über den schon
länger zurück liegenden Cybercrime-Report von Symantec Schumann
hat einen Aufhänger gesucht, gefunden und geht etwas unfair mit dem
Bericht von McAfee um. Geärgert hat er sich offenbar über den schon
länger zurück liegenden Cybercrime-Report von Symantec
 (4),
der auch nach meinem Geschmack zu oberflächlich und reißerisch war.
Schumann kritisiert besonders dessen Datenbasis: (4),
der auch nach meinem Geschmack zu oberflächlich und reißerisch war.
Schumann kritisiert besonders dessen Datenbasis:
 Grundlage
der Schreckensmeldung ist allerdings lediglich eine Umfrage, an der
gerade mal 12 500 Erwachsene teilnahmen – in 24 Ländern. Davon waren,
wie eine Unternehmenssprecherin einräumte, ganze 500 in Deutschland
ansässig. Deren Angaben rechneten die Symantec-Strategen kurzerhand auf
40 Millionen deutsche User hoch. Grundlage
der Schreckensmeldung ist allerdings lediglich eine Umfrage, an der
gerade mal 12 500 Erwachsene teilnahmen – in 24 Ländern. Davon waren,
wie eine Unternehmenssprecherin einräumte, ganze 500 in Deutschland
ansässig. Deren Angaben rechneten die Symantec-Strategen kurzerhand auf
40 Millionen deutsche User hoch.
 Solche
dünnen Erkenntnisgrundlagen nähren natürlich Zweifel an den horrenden
Schäden, die die Cybercrime laut Symantec und anderen verursachen soll.
Schumann verweist auf die Studie eines Teams um den "Experten für IT-Sicherheit
Ross Anderson", das jedenfalls keine sicheren Hinweis auf Schäden in
Milliardenhöhe auf den britischen Inseln gefunden haben will. Solche
dünnen Erkenntnisgrundlagen nähren natürlich Zweifel an den horrenden
Schäden, die die Cybercrime laut Symantec und anderen verursachen soll.
Schumann verweist auf die Studie eines Teams um den "Experten für IT-Sicherheit
Ross Anderson", das jedenfalls keine sicheren Hinweis auf Schäden in
Milliardenhöhe auf den britischen Inseln gefunden haben will.
 Das Spiel
mit Zahlen ist in Mode gekommen und Schumann geht auf inländische Verlautbarungen
ein, ohne die qualitative Bedeutung der
Cybercrime zu leugnen: Das Spiel
mit Zahlen ist in Mode gekommen und Schumann geht auf inländische Verlautbarungen
ein, ohne die qualitative Bedeutung der
Cybercrime zu leugnen:
 Tatsächlich summierten sich laut der Aufstellung der deutschen
Polizeibehörden die Beträge, die per Internet oder mit gestohlenen
Zugangsdaten erbeutet wurden, 2011 auf 71 Millionen Euro.
Tatsächlich summierten sich laut der Aufstellung der deutschen
Polizeibehörden die Beträge, die per Internet oder mit gestohlenen
Zugangsdaten erbeutet wurden, 2011 auf 71 Millionen Euro.
 Das
Kleinreden übernehmen andere Das
Kleinreden übernehmen andere
 (5).
Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung hat mit der ihm eigenen
Objektivität die polizeiliche Krimnalstatitik ausgewertet und
festgestellt (5).
Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung hat mit der ihm eigenen
Objektivität die polizeiliche Krimnalstatitik ausgewertet und
festgestellt
 (6): (6):
 Während die Zahl der registrierten Internetdelikte unter Geltung des
verfassungswidrigen Gesetzes zur Vorratsspeicherung im Jahr 2009 noch um
24% angestiegen war, war im Jahr 2011 nach dem Ende der
Vorratsdatenspeicherung ein Rückgang um 10% zu verzeichnen. Nur jede 25.
registrierte Straftat wird über das Internet begangen (3,7%). So ähnlich hatte schon das
Max-Planck-Institut im Rahmen seiner Machbarkeitsstudie argumentiert
Während die Zahl der registrierten Internetdelikte unter Geltung des
verfassungswidrigen Gesetzes zur Vorratsspeicherung im Jahr 2009 noch um
24% angestiegen war, war im Jahr 2011 nach dem Ende der
Vorratsdatenspeicherung ein Rückgang um 10% zu verzeichnen. Nur jede 25.
registrierte Straftat wird über das Internet begangen (3,7%). So ähnlich hatte schon das
Max-Planck-Institut im Rahmen seiner Machbarkeitsstudie argumentiert
 (7)
- was das Ganze auch nicht besser macht. (7)
- was das Ganze auch nicht besser macht.
Rötzer geht dazu auf Abstand:
 Von dem verbleibenden Anteil von 3,7 Prozent an Onlinedelikten waren
2,8 Prozent Internetbetrug und 0,1 Pornografie. Insgesamt gingen die
Straftaten, die unter Nutzung des Internets begangen wurden, gegenüber
2010 um 9,9 Prozent zurück. In den Jahren 2009 und 2010 war die Zahl der
Straftaten leicht gestiegen. Einen Zusammenhang mit der
Vorratsdatenspeicherung ist, wie der AK sagt, weder positiv noch negativ
zu erkennen.
Von dem verbleibenden Anteil von 3,7 Prozent an Onlinedelikten waren
2,8 Prozent Internetbetrug und 0,1 Pornografie. Insgesamt gingen die
Straftaten, die unter Nutzung des Internets begangen wurden, gegenüber
2010 um 9,9 Prozent zurück. In den Jahren 2009 und 2010 war die Zahl der
Straftaten leicht gestiegen. Einen Zusammenhang mit der
Vorratsdatenspeicherung ist, wie der AK sagt, weder positiv noch negativ
zu erkennen.
 Die Die
 Polizeiliche Kriminalstatistik ist ein untaugliches Mittel, um die
tatsächliche Dimension der Cybercrime zu erfassen
Polizeiliche Kriminalstatistik ist ein untaugliches Mittel, um die
tatsächliche Dimension der Cybercrime zu erfassen
 (8).
Sie zählt die bekannt gewordenen Fälle und lässt nur grobe
Vermutungen über das Dunkelfeld zu. Außerdem zählt sie nur die Taten,
die von Tätern im Inland ausgeführt werden. Großverfahren wie das gegen
die Erpresser mit dem Bundespolizeitrojaner zählen mit "Null", weil
die Täter
allein im Ausland gehandelt haben. Der Erfolgsort spielt statistisch
keine Rolle. Deshalb tauchen mehrere Tausend Betroffene, die
Strafanzeige erstattet haben, in der PKS überhaupt nicht auf. (8).
Sie zählt die bekannt gewordenen Fälle und lässt nur grobe
Vermutungen über das Dunkelfeld zu. Außerdem zählt sie nur die Taten,
die von Tätern im Inland ausgeführt werden. Großverfahren wie das gegen
die Erpresser mit dem Bundespolizeitrojaner zählen mit "Null", weil
die Täter
allein im Ausland gehandelt haben. Der Erfolgsort spielt statistisch
keine Rolle. Deshalb tauchen mehrere Tausend Betroffene, die
Strafanzeige erstattet haben, in der PKS überhaupt nicht auf.
Auch die Aufklärungsquote darf mit einem dicken Fragezeichen versehen
werden. Sie ist das leitende Qualitätsmerkmal für die polizeiliche
Aufklärungsarbeit und ganz häufig reicht ein loser Zusammenhang aus, um
die Tat zur aufgeklärten zu machen
 (9). (9).
|
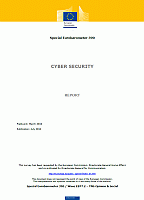 |

 74 Prozent der Teilnehmer an einer europaweiten Umfrage meinen, in
den vergangenen Jahren sei das Risiko gestiegen, Opfer von Cyber-Kriminalität
zu werden 74 Prozent der Teilnehmer an einer europaweiten Umfrage meinen, in
den vergangenen Jahren sei das Risiko gestiegen, Opfer von Cyber-Kriminalität
zu werden
 (10).
Umfragen wie die, die dem europäischen Cyber Security Report vom März
2012 zugrunde liegen (10).
Umfragen wie die, die dem europäischen Cyber Security Report vom März
2012 zugrunde liegen
 (11),
werden immer beliebter. Sie erheben jedoch nur die Befindlichkeit der
Befragten, nicht aber objektive Gefahren, Wirkungen und Schäden.
Entsprechend begrenzt ist ihr Aussagewert, auch wenn sie mit
Prozentzahlen daherkommen. Sie zählen nur subjektive Meinungen und
Bekundungen, mehr nicht. (11),
werden immer beliebter. Sie erheben jedoch nur die Befindlichkeit der
Befragten, nicht aber objektive Gefahren, Wirkungen und Schäden.
Entsprechend begrenzt ist ihr Aussagewert, auch wenn sie mit
Prozentzahlen daherkommen. Sie zählen nur subjektive Meinungen und
Bekundungen, mehr nicht.
 Den
Kritikern ist zuzustimmen, dass eine sichere, quantitative Aussage
zur Cybercrime und den verursachten Schäden nicht gemacht werden kann.
Recht verlässlich sind die Daten von der Den
Kritikern ist zuzustimmen, dass eine sichere, quantitative Aussage
zur Cybercrime und den verursachten Schäden nicht gemacht werden kann.
Recht verlässlich sind die Daten von der
 EURO
Kartensicherheit in Bezug auf das Skimming, so dass man wohl von
einem Skimming-Schaden in 2011 in Höhe von 60 Mio. € ausgehen kann. EURO
Kartensicherheit in Bezug auf das Skimming, so dass man wohl von
einem Skimming-Schaden in 2011 in Höhe von 60 Mio. € ausgehen kann.
Studien wie die von McAfee lassen hingegen qualitative Aussagen zu.
Danach verändert sich die Form der Cybercrime. Sie wird gezielter,
heimtückischer und professioneller.
 (1) (1)
 Harald Schumann, Die Angstmacher, Tagespiegel
14.07.2012
Harald Schumann, Die Angstmacher, Tagespiegel
14.07.2012
 (2) (2)

 Dave
Marcus, Ryan Sherstobitoff, Dissecting
Operation High Roller, McAfee 26.06.2012 Dave
Marcus, Ryan Sherstobitoff, Dissecting
Operation High Roller, McAfee 26.06.2012
 (3) (3)

 Operation High Roller: Online-Banking-Betrug im ganz großen Stil,
Heise online 26.06.2012
Operation High Roller: Online-Banking-Betrug im ganz großen Stil,
Heise online 26.06.2012
 (4) (4)
 Norton Cybercrime Report, September 2011
Norton Cybercrime Report, September 2011
 (5) (5)

 Florian Rötzer, Fehlende Vorratsdatenspeicherung hat
weder Internetkriminalität noch Aufklärung beeinflusst, Telepolis
09.07.2012
Florian Rötzer, Fehlende Vorratsdatenspeicherung hat
weder Internetkriminalität noch Aufklärung beeinflusst, Telepolis
09.07.2012
 (6) (6)
 Neue
Kriminalstatistik: Internet-Vorratsdatenspeicherung muss vom
Verhandlungstisch! vorratsdatenspeicherung.de 09.07.2012 Neue
Kriminalstatistik: Internet-Vorratsdatenspeicherung muss vom
Verhandlungstisch! vorratsdatenspeicherung.de 09.07.2012
 (7) (7)
 Machbarkeitsstudie ohne zureichende Daten und Instrumente,
29.01.2012
Machbarkeitsstudie ohne zureichende Daten und Instrumente,
29.01.2012
 (8) (8)

 Detlef Borchers, Internet-Kriminalität: Trau keiner
Statistik …, Heise online 22.05.2012
Detlef Borchers, Internet-Kriminalität: Trau keiner
Statistik …, Heise online 22.05.2012
 (9)
Von 5.770.785 staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren im Jahr 2007
wurden 4.259.773 auf "sonstige Weise" erledigt (73,8 %), also durch
Einstellungen und Verfahrensverbindungen. Siehe: (9)
Von 5.770.785 staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren im Jahr 2007
wurden 4.259.773 auf "sonstige Weise" erledigt (73,8 %), also durch
Einstellungen und Verfahrensverbindungen. Siehe:

 Jörg-Martin
Jehle, Strafrechtspflege in Deutschland, BMJ
27.01.2009, S. 18. Jörg-Martin
Jehle, Strafrechtspflege in Deutschland, BMJ
27.01.2009, S. 18.
 (10) (10)

 Stefan Krempl, Immer mehr EU-Bürger haben Angst vor
Cyber-Kriminalität, Heise online 10.07.2012
Stefan Krempl, Immer mehr EU-Bürger haben Angst vor
Cyber-Kriminalität, Heise online 10.07.2012
 (11) (11)

 European Comission, Cyber Security Report, 03.07.2012
European Comission, Cyber Security Report, 03.07.2012
|



 |
der Fall Uwe Barschel |
|
 
|
 Am
11.10.1987 verstarb der frühere Ministerpräsident Schleswig-Holsteins,
Uwe Barschel, unter mysteriösen Umständen in einem Hotel in Genf unter
der Einwirkung mehrerer giftiger Medikamente. Seither werden verschiedene Theorien immer
wieder neu belebt, die vom Freitod über die Tötung auf Verlangen bis zum
Mord reichen. Seit 1992 führte der Leitende Oberstaatsanwalt aus Lübeck,
Heinrich Wille, die Ermittlungen - gegen vielfältige Widerstände aus
Justiz, Verwaltung und Politik. Er jedenfall ist davon überzeugt, dass
Barschel ermordet wurde. Sein 2007 geschriebenes Buch erschien im August
2011. Am
11.10.1987 verstarb der frühere Ministerpräsident Schleswig-Holsteins,
Uwe Barschel, unter mysteriösen Umständen in einem Hotel in Genf unter
der Einwirkung mehrerer giftiger Medikamente. Seither werden verschiedene Theorien immer
wieder neu belebt, die vom Freitod über die Tötung auf Verlangen bis zum
Mord reichen. Seit 1992 führte der Leitende Oberstaatsanwalt aus Lübeck,
Heinrich Wille, die Ermittlungen - gegen vielfältige Widerstände aus
Justiz, Verwaltung und Politik. Er jedenfall ist davon überzeugt, dass
Barschel ermordet wurde. Sein 2007 geschriebenes Buch erschien im August
2011.
Heinrich Wille, Ein Mord, der keiner sein durfte,
Rotpunktverlag 2011,
Bestellung bei  
 Willes Buch
nimmt Markus Kompa bei Willes Buch
nimmt Markus Kompa bei
 zum Anlass, über
der Fall Barschel, dessen möglichen Verwicklungen mit dem
internationalen Waffenhandel, Geheimdiensten und die besonderen Umstände
seines Todes zu berichten. Er liefert genügend Material für eine ganze
Serien von Kriminalromanen und natürlich für Verschwörungstheorien. zum Anlass, über
der Fall Barschel, dessen möglichen Verwicklungen mit dem
internationalen Waffenhandel, Geheimdiensten und die besonderen Umstände
seines Todes zu berichten. Er liefert genügend Material für eine ganze
Serien von Kriminalromanen und natürlich für Verschwörungstheorien.

 Markus
Kompa, Tod eines Politikers, Telepolis 15.07.2012 Markus
Kompa, Tod eines Politikers, Telepolis 15.07.2012


 Markus Kompa, Barschels Mörder? Telepolis
16.07.2012
Markus Kompa, Barschels Mörder? Telepolis
16.07.2012
 Selbst wenn
sich die Anzeichen für einen Mord verdichtet haben, so muss das
nicht heißen, dass dazu auch der passende Mörder gefunden wird. Dem
widmet sich der zweite Teil, der viel Material, aber keine knackigen
Ergebnisse liefert. Selbst wenn
sich die Anzeichen für einen Mord verdichtet haben, so muss das
nicht heißen, dass dazu auch der passende Mörder gefunden wird. Dem
widmet sich der zweite Teil, der viel Material, aber keine knackigen
Ergebnisse liefert.
|