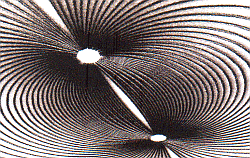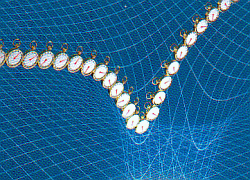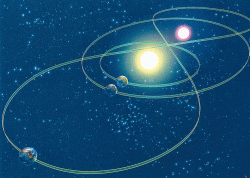|
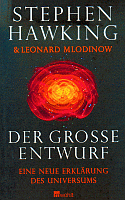
|
  Wer das Buch von Rüdiger Vaas gelesen hat
Wer das Buch von Rüdiger Vaas gelesen hat
 (1),
der erfährt hier nicht viel Neues über Hawkings aktuellen Gedankenmodelle.
Deshalb wollte ich das Gemeinschaftswerk von Hawking und Mlodinow (1),
der erfährt hier nicht viel Neues über Hawkings aktuellen Gedankenmodelle.
Deshalb wollte ich das Gemeinschaftswerk von Hawking und Mlodinow
 (2)
zunächst wieder beiseite legen. Zum Glück fing ich an zu blättern und
verfing mich an den Grafiken von Peter Bollinger, die mir ständig
signalisierten: Das kenne ich doch auch! Schön gemacht! (2)
zunächst wieder beiseite legen. Zum Glück fing ich an zu blättern und
verfing mich an den Grafiken von Peter Bollinger, die mir ständig
signalisierten: Das kenne ich doch auch! Schön gemacht!
Visualisierungen sind besonders schwierig, wenn sie sehr abstrakte
Prozesse beschreiben sollen. Das gelingt Bollinger auf eine besondere
und eingängige Art. Das zu demonstrieren, geht nur mit Bildzitaten. Ich
habe dazu sechs Beispiele ausgewählt, die mir besonders gefallen haben
und die eine kleine Geschichte erzählen. Ihre volle Pracht entfalten die
Bilder aber nur in dem Buch. Das soll aber auch so sein.
|
 Die Autoren ziehen einen langen Bogen und berichten zunächst über magnetische
Kraftfeldlinien (Ausschnitt von S. 89,
Die Autoren ziehen einen langen Bogen und berichten zunächst über magnetische
Kraftfeldlinien (Ausschnitt von S. 89,  unten links). Eigentlich handelt es sich nur um Eisenspäne, die sich
entlang eines magnetischen Kraftfeldes ausrichten.
unten links). Eigentlich handelt es sich nur um Eisenspäne, die sich
entlang eines magnetischen Kraftfeldes ausrichten.
Das nächste Bild zeigt Interferenzen, wobei sich Wellen gegenseitig
überlagern (Ausschnitt von S. 57,  unten Mitte). Besonders schön: Im Zentrum der Quirls schwimmen Quietscheentchen und die symbolisieren Badewanne und gemächliches
Treiben auf einer Wasseroberfläche. Das wirkt hochgradig
harmonisch und ist gut anzusehen.
unten Mitte). Besonders schön: Im Zentrum der Quirls schwimmen Quietscheentchen und die symbolisieren Badewanne und gemächliches
Treiben auf einer Wasseroberfläche. Das wirkt hochgradig
harmonisch und ist gut anzusehen.
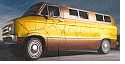 Das Bild Das Bild
 rechts unten (S. 109) zeigt den Van von Richard Feynman, auf dem Feynmans
Diagramme für die Interaktion von Elementarteilchen aufgemalt sind. Sie
zeigen den Zerfall und die Fusion im Zusammenhang mit kernphysikalischen
Prozessen, wie sie oberhalb der Quarkebene stattfinden.
rechts unten (S. 109) zeigt den Van von Richard Feynman, auf dem Feynmans
Diagramme für die Interaktion von Elementarteilchen aufgemalt sind. Sie
zeigen den Zerfall und die Fusion im Zusammenhang mit kernphysikalischen
Prozessen, wie sie oberhalb der Quarkebene stattfinden.
|
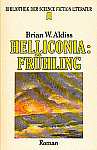
|
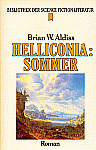 |
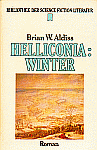 |
 Das Bild
Das Bild
 unten links (Ausschnitt
von S. 134) visualisiert die Zeitdehnung (Dilation) unter dem
Einfluss starker Gravitation. Das Gedankenmodell stammt von Albert
Einstein (Allgemeine Relativitätstheorie). In seiner (jetzt
experimentell gesicherten) Vorstellung von der Raumzeit bilden weder der
Raum noch die Zeit feste Größen. Sie sind abhängig von ihrer Bewegung
(Inertialsystem) und der Schwerkraft. Das Bild zeigt einen
Gravitationstrichter, in dem sich die individuelle Zeitwahrnehmung des
Beobachters dehnt, je mehr er sich der Masse im Trichter nähert. Das
symbolisieren die kleinen Uhren. Dieselbe Wirkung hat die
Eigengeschwindigkeit des Beobachters, je mehr er sich der
Lichtgeschwindigkeit nähert. Für Objekte, die sich mit
Lichtgeschwindigkeit bewegen, vergeht äußerlich keine Zeit. unten links (Ausschnitt
von S. 134) visualisiert die Zeitdehnung (Dilation) unter dem
Einfluss starker Gravitation. Das Gedankenmodell stammt von Albert
Einstein (Allgemeine Relativitätstheorie). In seiner (jetzt
experimentell gesicherten) Vorstellung von der Raumzeit bilden weder der
Raum noch die Zeit feste Größen. Sie sind abhängig von ihrer Bewegung
(Inertialsystem) und der Schwerkraft. Das Bild zeigt einen
Gravitationstrichter, in dem sich die individuelle Zeitwahrnehmung des
Beobachters dehnt, je mehr er sich der Masse im Trichter nähert. Das
symbolisieren die kleinen Uhren. Dieselbe Wirkung hat die
Eigengeschwindigkeit des Beobachters, je mehr er sich der
Lichtgeschwindigkeit nähert. Für Objekte, die sich mit
Lichtgeschwindigkeit bewegen, vergeht äußerlich keine Zeit.
 Das Bild
Das Bild
 unten Mitte (S. 148) zeigt das Schema planetarischer Umlaufbahnen in
einem Doppelsternsystem, wobei es Bollinger und den Autoren um die Bewohnbarkeit geht, also den
Gürteln um Sonnen, in denen theoretisch Leben entstehen, sich entwickeln
und überleben kann.
unten Mitte (S. 148) zeigt das Schema planetarischer Umlaufbahnen in
einem Doppelsternsystem, wobei es Bollinger und den Autoren um die Bewohnbarkeit geht, also den
Gürteln um Sonnen, in denen theoretisch Leben entstehen, sich entwickeln
und überleben kann.
Die Planeten können eine Sonne mehr oder weniger kreisförmig
umlaufen. Ihre ellipsoiden Umlaufbahnen, die durch die Partnersonne in
Doppelsternsystemen noch
weiter verzerrt werden, können halbwegs gleiche Jahreszeiten
verursachen.
|
Eine Ellipse ist ein gedehnter Kreis um zwei Mittelpunkte
mit gleichbleibende Summe der geometrischen Schenkel. Das wirkt sich besonders bei solchen
Planeten aus, die äußerlich beide Sonnen umlaufen. Sie zeigen extreme
Jahreszeitenschwankungen: Heiße Sommer
bei der größten Annäherung an den heißeren Sternpartner, lange Frühlinge
und Herbste und beim Umrunden des kühleren Sternpartners kann ein
Zwischensommer entstehen, wenn der Stern warm genug ist.
Eine ähnliche
Konstellation hat Brian W. Alsdiss in
seinem Helliconia-Zyklus literarisch umgesetzt
 (3). Dort
umkreist der belebte Planet eine leuchtschwache Sonne, die ihrerseits
eine sehr heiße Sonne umkreist, von der letztlich die Jahreszeiten
bestimmt werden. (3). Dort
umkreist der belebte Planet eine leuchtschwache Sonne, die ihrerseits
eine sehr heiße Sonne umkreist, von der letztlich die Jahreszeiten
bestimmt werden.
Richtig extrem werden schleifenförmige Bahnen um beide Sonnen des
Doppelsternsystems. Der Planet erlebt extreme, aber kurze Sommer in der Nähe der
beiden Sonnen, schnell vergehende Frühlinge und Herbste und sehr extreme
und lange Winter bei
den weiten Entfernungen von den Partnersonnen.
 Das letzte Bild in dieser Reihe visualisiert den Butterfly-Effekt aus
der Quantentheorie des Chaos' (S. 146,
Das letzte Bild in dieser Reihe visualisiert den Butterfly-Effekt aus
der Quantentheorie des Chaos' (S. 146,  unten rechts): Der Flügelschlag eines Schmetterlinks kann sich durch
Wechselwirkungen und Interferenzen derart verstärken, dass er am anderen
Ende der Welt einen Wirbelsturm oder einen Tsunami verursacht. Ich halte
das gedankliche Bild für stark überzeichnet, aber nicht falsch.
Ihm wirken die Stabilisierungskräfte entgegen, in erster Linie die alle
Bewegungen hemmende Schwerkraft und die Umgebungsstrukturen, die bewegt
und korrodiert werden wollen - auch von den Flügelschlägen eines
Schmetterlinks.
unten rechts): Der Flügelschlag eines Schmetterlinks kann sich durch
Wechselwirkungen und Interferenzen derart verstärken, dass er am anderen
Ende der Welt einen Wirbelsturm oder einen Tsunami verursacht. Ich halte
das gedankliche Bild für stark überzeichnet, aber nicht falsch.
Ihm wirken die Stabilisierungskräfte entgegen, in erster Linie die alle
Bewegungen hemmende Schwerkraft und die Umgebungsstrukturen, die bewegt
und korrodiert werden wollen - auch von den Flügelschlägen eines
Schmetterlinks.
|
|
|
 (1) (1)
 Zeitgeschichte der Kosmologie, 07.08.2010
Zeitgeschichte der Kosmologie, 07.08.2010
 (2)
Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, Der Große Entwurf. Eine neue Erklärung des Universiums, Rowohlt 2010; (2)
Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, Der Große Entwurf. Eine neue Erklärung des Universiums, Rowohlt 2010;
Bestellung bei  
 (3)
Brian W. Aldiss, (3)
Brian W. Aldiss,
Helliconia: Frühling (1982), Cover: Heyne 1985,
Helliconia: Sommer (1983), Cover: Heyne 1985,
Helliconia: Winter (1985), Cover: Heyne 1985
Bestellung bei  (antiquarisch) (antiquarisch)
|
|