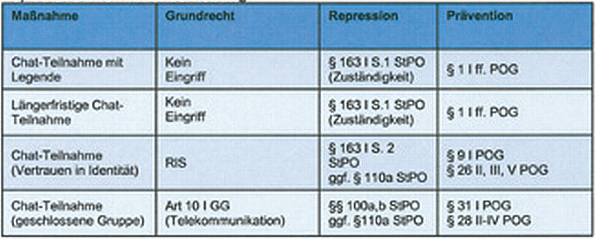|
|
Antworten der
Bundesregierung. Überprüfung meiner Arbeitsergebnisse.
|
|
 In einem Aufsatz der Zeitschrift „Kriminalistik“ (1/2010, S. 30)
nennen die Polizeidozenten Axel Henrichs und Jörg Wilhelm soziale
Netzwerke „wahre Fundgruben“ für „allgemeine Ermittlungs- und
Fahndungszwecke“ ebenso wie für „präventionspolizeiliche Maßnahmen“. Die
Daten aus den sozialen Netzwerken seien von „hohem taktischen Nutzen“.
In einem Aufsatz der Zeitschrift „Kriminalistik“ (1/2010, S. 30)
nennen die Polizeidozenten Axel Henrichs und Jörg Wilhelm soziale
Netzwerke „wahre Fundgruben“ für „allgemeine Ermittlungs- und
Fahndungszwecke“ ebenso wie für „präventionspolizeiliche Maßnahmen“. Die
Daten aus den sozialen Netzwerken seien von „hohem taktischen Nutzen“. |
|
 Der Wert der erlangten Informationen könnte laut dem Artikel in der
Zeitschrift „Kriminalistik" insbesondere dann erhöht werden, wenn sie
mit Informationen der Polizeidatenbanken und verdeckten Ermittlungen
kombiniert würden. Hierfür fehlt allerdings die rechtliche Grundlage.
Der Wert der erlangten Informationen könnte laut dem Artikel in der
Zeitschrift „Kriminalistik" insbesondere dann erhöht werden, wenn sie
mit Informationen der Polizeidatenbanken und verdeckten Ermittlungen
kombiniert würden. Hierfür fehlt allerdings die rechtliche Grundlage.
|
|
 Eine kleine
Anfrage von Abgeordneten der Fraktion DIE LINKEN zur Nutzung sozialer
Netzwerke zu Fahndungszwecken Eine kleine
Anfrage von Abgeordneten der Fraktion DIE LINKEN zur Nutzung sozialer
Netzwerke zu Fahndungszwecken
 (1)
bezieht sich auf verschiedene Veröffentlichungen in der polizeilichen
Fachpresse (siehe (1)
bezieht sich auf verschiedene Veröffentlichungen in der polizeilichen
Fachpresse (siehe
 <links>). Die Antwort der Bundesregierung darauf wirkt zunächst etwas karg,
birgt aber auch interessante Informationen
<links>). Die Antwort der Bundesregierung darauf wirkt zunächst etwas karg,
birgt aber auch interessante Informationen
 (2): (2):
|
|
|
Ermittlungen im Internet seien sowohl zur
Gefahrenabwehr als auch zur Strafverfolgung wichtig. Im Einzelfall
würden öffentlich zugängliche Informationen aus dem Internet beschafft:
 Das Bundeskriminalamt (BKA), die Bundespolizei (BPOL) und der
Zollfahndungsdienst
nutzen bei der Kriminalitätsbekämpfung fallbezogen u. a.
offen
zugängliche Informationen aus sozialen Netzwerken. Es wird keine
systematische
und anlassunabhängige Recherche in sozialen Netzwerken durchgeführt.
Das Bundeskriminalamt (BKA), die Bundespolizei (BPOL) und der
Zollfahndungsdienst
nutzen bei der Kriminalitätsbekämpfung fallbezogen u. a.
offen
zugängliche Informationen aus sozialen Netzwerken. Es wird keine
systematische
und anlassunabhängige Recherche in sozialen Netzwerken durchgeführt.
 Nehmen Beamte des BKA
legendiert an einer
Kommunikation in einer geschlossenen
Benutzergruppe in einem sozialen Netzwerk teil und nutzen sie
dabei Zugangsschlüssel, die sie ohne Zustimmung eines anderen Kommunikationsteilnehmers
erhoben haben, kann dies nur unter den Voraussetzungen der
§§ 100a, 100b, 110a ff. der StPO bzw. §§ 20l, 20g Absatz 2 Nummer 5 des
BKAG zulässig sein. Nehmen Beamte des BKA
legendiert an einer
Kommunikation in einer geschlossenen
Benutzergruppe in einem sozialen Netzwerk teil und nutzen sie
dabei Zugangsschlüssel, die sie ohne Zustimmung eines anderen Kommunikationsteilnehmers
erhoben haben, kann dies nur unter den Voraussetzungen der
§§ 100a, 100b, 110a ff. der StPO bzw. §§ 20l, 20g Absatz 2 Nummer 5 des
BKAG zulässig sein.
Wegen der Bedenken, die der
Bundesdatenschutzbeauftragte geäußert hat, heißt es in der Antwort:
 Das schutzwürdige Vertrauen
in die Identität des Kommunikationspartners markiert
den Wechsel von
der reinen Internetaufklärung, die keinen Grundrechtseingriff darstellt,
hin zu
einem Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung,
der
einer gesetzlichen Grundlage bedarf.
Das schutzwürdige Vertrauen
in die Identität des Kommunikationspartners markiert
den Wechsel von
der reinen Internetaufklärung, die keinen Grundrechtseingriff darstellt,
hin zu
einem Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung,
der
einer gesetzlichen Grundlage bedarf.
Erhellend sind die Ausführungen zu den
tatsächlich durchgeführten Ermittlungen seitens des BKA:
 Das BKA setzt für eine längerfristige, gezielte Teilnahme an der
Kommunikation
in sozialen Netzwerken nach Anordnung der Staatsanwaltschaft sogenannte
virtuelle Verdeckte Ermittler ein. Die Einsätze finden auf der
Rechtsgrundlage
und nach Maßgabe der §§ 110a ff. der StPO statt.
Im Rahmen der Strafverfolgung wurden innerhalb der zurückliegenden 24
Monate
in sechs Ermittlungsverfahren „virtuelle“ Verdeckte Ermittler durch das
BKA eingesetzt.
Das BKA setzt für eine längerfristige, gezielte Teilnahme an der
Kommunikation
in sozialen Netzwerken nach Anordnung der Staatsanwaltschaft sogenannte
virtuelle Verdeckte Ermittler ein. Die Einsätze finden auf der
Rechtsgrundlage
und nach Maßgabe der §§ 110a ff. der StPO statt.
Im Rahmen der Strafverfolgung wurden innerhalb der zurückliegenden 24
Monate
in sechs Ermittlungsverfahren „virtuelle“ Verdeckte Ermittler durch das
BKA eingesetzt.
Zur Keuschheitsprobe:
 §§ 110a ff. der StPO enthalten keine Befugnis
zur Begehung milieubedingter Straftaten. Damit kommen <der
Aufruf zu Straftaten, das Verfassen strafbarer Texte und die Weitergabe
von Dateien mit strafbarem Inhalt> für
§§ 110a ff. der StPO enthalten keine Befugnis
zur Begehung milieubedingter Straftaten. Damit kommen <der
Aufruf zu Straftaten, das Verfassen strafbarer Texte und die Weitergabe
von Dateien mit strafbarem Inhalt> für
„virtuelle“ Verdeckte Ermittler regelmäßig nicht in Betracht,
ausnahmsweise
dann, wenn sie nach den allgemeinen Regelungen rechtmäßig sind.
Schließlich bestreitet die Bundesregierung, dass
von den Bundespolizeibehörden Methoden des Profiling und des Data Mining
eingesetzt werden (automatische Erhebung von Daten und ihre Verknüpfung
mit polizeilichen Datensammlungen).
|



 |
Keine Widersprüche, aber Hintertüren |
|
 Ein entschuldigender Notstand im Sinne des § 35 StGB
kann nicht angenommen
werden. Die Verantwortung für das entführte Kind ergab sich aus der
Verpflichtung
der polizeilichen Gefahrenabwehr. Ein Näheverhältnis, wie es
§ 35 StGB verlangt, war nicht gegeben. Nach dieser Vorschrift sind nur
Angehörige
und Personen, die dem Opfer nahe stehen, wegen der persönlichen
Beziehung und
Konfliktsituation entschuldigt, nicht jedoch Polizeibeamte.
Ein entschuldigender Notstand im Sinne des § 35 StGB
kann nicht angenommen
werden. Die Verantwortung für das entführte Kind ergab sich aus der
Verpflichtung
der polizeilichen Gefahrenabwehr. Ein Näheverhältnis, wie es
§ 35 StGB verlangt, war nicht gegeben. Nach dieser Vorschrift sind nur
Angehörige
und Personen, die dem Opfer nahe stehen, wegen der persönlichen
Beziehung und
Konfliktsituation entschuldigt, nicht jedoch Polizeibeamte.
 (4) (4) |
|
  Mit der geschlossenen Darstellung der Ermittlungsmaßnahmen für das
Internet mag ich Neuland betreten haben
Mit der geschlossenen Darstellung der Ermittlungsmaßnahmen für das
Internet mag ich Neuland betreten haben
 (3).
Das gilt besonders für meine strenge Abgrenzung zwischen dem nach
Maßgabe der Ermittlungsgeneralklausel ( (3).
Das gilt besonders für meine strenge Abgrenzung zwischen dem nach
Maßgabe der Ermittlungsgeneralklausel ( § 161 Abs. 1 S. 1 StPO) zulässigen Nicht offen ermittelnden
Polizeibeamten - NoeP - und dem Verdeckten Ermittler (
§ 161 Abs. 1 S. 1 StPO) zulässigen Nicht offen ermittelnden
Polizeibeamten - NoeP - und dem Verdeckten Ermittler ( §§ 110a,
§§ 110a,
 110b StPO). Bei den grundsätzlichen Rechtsfragen im einzelnen
besteht Einklang mit den Bewertungen, die das Bundesinnenministerium in
der Antwort vertreten hat.
110b StPO). Bei den grundsätzlichen Rechtsfragen im einzelnen
besteht Einklang mit den Bewertungen, die das Bundesinnenministerium in
der Antwort vertreten hat.
 Interessant
sind die Zwischentöne, die sich in Andeutungen ausdrücken. Das zeigt
sich zunächst in der verschämten Nennung des Interessant
sind die Zwischentöne, die sich in Andeutungen ausdrücken. Das zeigt
sich zunächst in der verschämten Nennung des
 § 110a StPO, wohinter sich sowohl ein staatsanwaltschaftlich als
auch gerichtlich genehmigter Einsatz eines Verdeckten Ermittlers
verbergen kann. Eine Abgrenzung nach Eingriffsintensität und Dauer, wie ich es
unternommen habe, macht die Antwort nicht, offenbart aber schließlich
sechs Einsätze eines Verdeckten Ermittlers in Strafverfahren
auf
Anordnung der Staatsanwaltschaft. Das spricht für Einsätze ohne
gerichtlichen Beschluss (siehe
§ 110a StPO, wohinter sich sowohl ein staatsanwaltschaftlich als
auch gerichtlich genehmigter Einsatz eines Verdeckten Ermittlers
verbergen kann. Eine Abgrenzung nach Eingriffsintensität und Dauer, wie ich es
unternommen habe, macht die Antwort nicht, offenbart aber schließlich
sechs Einsätze eines Verdeckten Ermittlers in Strafverfahren
auf
Anordnung der Staatsanwaltschaft. Das spricht für Einsätze ohne
gerichtlichen Beschluss (siehe
 § 110b Abs. 2 StPO),
den ich für längerfristige Einsätze gegen "bestimmte Beschuldigte"
fordere. § 110b Abs. 2 StPO),
den ich für längerfristige Einsätze gegen "bestimmte Beschuldigte"
fordere.
Interessant ist im Zusammenhang mit
 Zugangsschlüssel, die sie ohne Zustimmung eines anderen
Kommunikationsteilnehmers erhoben haben, das Wort
erhoben. Es besagt, dass eine Zugangskennung nicht im Wege der Kommunikation,
sondern durch technische Mittel erlangt wurde. Das steht im Einklang mit
der Nennung der
Zugangsschlüssel, die sie ohne Zustimmung eines anderen
Kommunikationsteilnehmers erhoben haben, das Wort
erhoben. Es besagt, dass eine Zugangskennung nicht im Wege der Kommunikation,
sondern durch technische Mittel erlangt wurde. Das steht im Einklang mit
der Nennung der
 §§ 100a,
§§ 100a,
 100b StPO, die sich auf die Überwachung der Telekommunikation
beziehen. "Zugangsschlüssel" werden gemeinhin nicht im Telefongespräch
übermittelt, so dass sich die Überwachung nur auf die textliche
Kommunikation beziehen kann, also auf E-Mails oder andere
Kommunikationsdienste. Das belegen auch die Hinweise auf die
100b StPO, die sich auf die Überwachung der Telekommunikation
beziehen. "Zugangsschlüssel" werden gemeinhin nicht im Telefongespräch
übermittelt, so dass sich die Überwachung nur auf die textliche
Kommunikation beziehen kann, also auf E-Mails oder andere
Kommunikationsdienste. Das belegen auch die Hinweise auf die
 §§ 20l (TKÜ) und
§§ 20l (TKÜ) und
 20g Abs. 2 Nr. 5 BKAG (Verdeckter Ermittler).
20g Abs. 2 Nr. 5 BKAG (Verdeckter Ermittler).
 Schließlich
offenbaren die Worte zur Keuschheitsprobe eine Hintertür: Zweifellos
richtig ist, dass die Schließlich
offenbaren die Worte zur Keuschheitsprobe eine Hintertür: Zweifellos
richtig ist, dass die
 §§ 110a ff. der StPO ... keine Befugnis zur
Begehung milieubedingter Straftaten enthalten, dem der Verweis auf
allgemeine Regelungen folgt. Das kann als Hinweis auf §§ 110a ff. der StPO ... keine Befugnis zur
Begehung milieubedingter Straftaten enthalten, dem der Verweis auf
allgemeine Regelungen folgt. Das kann als Hinweis auf  § 161 Abs. 1 S. 1 StPO verstanden werden, also auf die
kriminalistische List unterhalb von Maßnahmen, die messbar in
Grundrechte eingreifen, aber auch auf einen rechtfertigenden (
§ 161 Abs. 1 S. 1 StPO verstanden werden, also auf die
kriminalistische List unterhalb von Maßnahmen, die messbar in
Grundrechte eingreifen, aber auch auf einen rechtfertigenden ( § 34 StGB) oder entschuldigenden Notstand hinweisen
§ 34 StGB) oder entschuldigenden Notstand hinweisen
 § 35 StGB. Der entschuldigende Notstand würde aber nach einer
gewissen persönlichen Nähe verlangen
§ 35 StGB. Der entschuldigende Notstand würde aber nach einer
gewissen persönlichen Nähe verlangen
 (4),
die dem stellvertretenden Polizeipräsidenten in Frankfurt im Fall "Gäfgen"
nicht zugestanden worden ist (4),
die dem stellvertretenden Polizeipräsidenten in Frankfurt im Fall "Gäfgen"
nicht zugestanden worden ist
 (5). (5).
|



 |
zwischen NoeP und VE |
|
|
 Der in der
Anfrage genannten Aufsatz von Henrichs und Wilhelm in der Zeitschrift
Kriminalistik ist nicht frei verfügbar Der in der
Anfrage genannten Aufsatz von Henrichs und Wilhelm in der Zeitschrift
Kriminalistik ist nicht frei verfügbar
 (6),
wohl aber ein noch jüngerer Aufsatz, der eine Auseinandersetzung lohnt (6),
wohl aber ein noch jüngerer Aufsatz, der eine Auseinandersetzung lohnt
 (7). (7).
Henrichs ist der Leiter des Fachgebiets
Eingriffsrecht an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in
Rheinland-Pfalz und Wilhelm Dozent ebenda. Auch sie orientieren sich an
dem Urteil des BVerfG zur Onlinedurchsuchung
 (8)
und heben dessen Aussagen hervor, dass die Informationsbeschaffung aus
dem Internet, die Nutzung von Fake Accounts und die Teilnahme an der
Kommunikation in sozialen Netzen Maßnahmen ohne grundrechtsrelevante
Eingriffstiefen sind, die aufgrund der Ermittlungsgeneralklausel
gerechtfertigt sind <S. 8>. Dem folgen längere Ausführungen über die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für soziale Netzwerke und ob sich die
Polizei darüber hinweg setzen darf. Das ist ein Problem des NoeP, der
nicht von (8)
und heben dessen Aussagen hervor, dass die Informationsbeschaffung aus
dem Internet, die Nutzung von Fake Accounts und die Teilnahme an der
Kommunikation in sozialen Netzen Maßnahmen ohne grundrechtsrelevante
Eingriffstiefen sind, die aufgrund der Ermittlungsgeneralklausel
gerechtfertigt sind <S. 8>. Dem folgen längere Ausführungen über die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für soziale Netzwerke und ob sich die
Polizei darüber hinweg setzen darf. Das ist ein Problem des NoeP, der
nicht von
 § 110a Abs. 2 S. 2 StPO zur Teilnahme am Rechtsverkehr berechtigt
wird. Die Autoren behelfen sich damit, dass sie zivilrechtliche
Allgemeinregelungen gegen öffentlich-rechtliche Eingriffsermächtigungen
zurücktreten lassen, womit sie sicherlich recht haben <S. 9>.
§ 110a Abs. 2 S. 2 StPO zur Teilnahme am Rechtsverkehr berechtigt
wird. Die Autoren behelfen sich damit, dass sie zivilrechtliche
Allgemeinregelungen gegen öffentlich-rechtliche Eingriffsermächtigungen
zurücktreten lassen, womit sie sicherlich recht haben <S. 9>.
Soweit die Autoren auf offene Erhebungen und
Auskunftsverlangen eingehen, besteht kein Widerspruch gegenüber meinen
Ausführungen. Mir kommt nur zugute, dass ich neue Rechtsprechung
berücksichtigen konnte, die ihnen noch unbekannt war.
Spannend wird es bei Frage, die sie als "aktive
Informationserhebung" übertiteln (siehe Schaubild
 <unten>). Bei der - auch längerfristigen - Chatteilnahme und bei der
Frage nach der damit verbundenen Vertrauensbildung sind wir derselben
Meinung. Auch schon dort weist die Tabelle den Eintrag auf:
<unten>). Bei der - auch längerfristigen - Chatteilnahme und bei der
Frage nach der damit verbundenen Vertrauensbildung sind wir derselben
Meinung. Auch schon dort weist die Tabelle den Eintrag auf:
 ggf.
ggf.
 § 110a StPO. Das zeigt, dass auch sie die Vorschriften über den
Verdeckten Ermittler einschlägig sehen. Das wiederholt sich in Bezug auf
die geschlossenen Benutzergruppen.
§ 110a StPO. Das zeigt, dass auch sie die Vorschriften über den
Verdeckten Ermittler einschlägig sehen. Das wiederholt sich in Bezug auf
die geschlossenen Benutzergruppen.
Die Autoren winden sich dann aber und bekennen im Text
des Aufsatzes keine klare Farbe. Den Grund dafür deuten sie an <S. 10>:
|
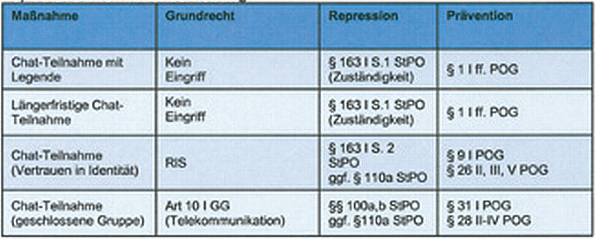 |
 Der
Einsatz verdeckt ermittelnder Polizeibeamter in der „realen Welt“
bereitet kaum mehr Schwierigkeiten, da die Bezeichnungen VE (verdeckte
Ermittler)
und noeP (nicht offen ermittelnder Polizeibeamter)
auch verwaltungsintern klar
differenziert werden und deren Einsatz
zum Teil strengen Regularien unterliegt.
Für verdeckte Ermittlungen im „virtuellen“
Raum bestehen allerdings lediglich
andeutungsweise klare Anweisungen
oder Vorschriften. Der
Einsatz verdeckt ermittelnder Polizeibeamter in der „realen Welt“
bereitet kaum mehr Schwierigkeiten, da die Bezeichnungen VE (verdeckte
Ermittler)
und noeP (nicht offen ermittelnder Polizeibeamter)
auch verwaltungsintern klar
differenziert werden und deren Einsatz
zum Teil strengen Regularien unterliegt.
Für verdeckte Ermittlungen im „virtuellen“
Raum bestehen allerdings lediglich
andeutungsweise klare Anweisungen
oder Vorschriften.
Die Brisanz liegt in dem Wort
verwaltungsintern und besonders in dem falschen Wort
auch. |
|
|
Es folgt ein Ausflug zu Allgemeinheiten,
 Während der Einsatz eines noeP/VE
in der „realen Welt“ meist auch mit der
persönlichen, unmittelbaren Kontaktaufnahme
zum Beschuldigten verbunden ist,
sind nicht offen geführte Ermittlungen im
Internet schon von vorne herein anders
angelegt. Sie zeichnen sich durch mehr
Anonymität und Distanz aus, sind nicht
vergleichbar operativ ausgerichtet. Während der Einsatz eines noeP/VE
in der „realen Welt“ meist auch mit der
persönlichen, unmittelbaren Kontaktaufnahme
zum Beschuldigten verbunden ist,
sind nicht offen geführte Ermittlungen im
Internet schon von vorne herein anders
angelegt. Sie zeichnen sich durch mehr
Anonymität und Distanz aus, sind nicht
vergleichbar operativ ausgerichtet.
und dann eine Referenz an das BVerfG, die
die Argumentationslücke überspringt, aber nicht retten kann.
|



 |
die Lücke zwischen NoeP und VE |
|
|
 Wir haben
den NoeP mit einer klar umgrenzten Ermittlungsaufgabe (Scheinkauf,
Identifizierung, Zugriff), der von der Rechtsprechung akzeptiert ist und
seine Berechtigung aus der Ermittlungsgeneralklausel bezieht. Das andere
Extrem bildet der Verdeckte Ermittler, der nach langwieriger Ausbildung
und operativer Vorbereitung an besonders gefährliche Täter und
Tätergruppen herangeführt wird und erfahrungsgemäß hochgradig gefährdet
ist ( Wir haben
den NoeP mit einer klar umgrenzten Ermittlungsaufgabe (Scheinkauf,
Identifizierung, Zugriff), der von der Rechtsprechung akzeptiert ist und
seine Berechtigung aus der Ermittlungsgeneralklausel bezieht. Das andere
Extrem bildet der Verdeckte Ermittler, der nach langwieriger Ausbildung
und operativer Vorbereitung an besonders gefährliche Täter und
Tätergruppen herangeführt wird und erfahrungsgemäß hochgradig gefährdet
ist ( § 110b Abs. 3 S. 3 StPO). Seine Identität darf auch unter dem Gesichtspunkt
geheimgehalten werden, dass er erneut eingesetzt werden soll ("weitere
Verwendung"). Die polizeirechtlich ausgerichteten Kommentatoren lassen
dabei zu häufig unerwähnt, dass der anonyme VE ein schlechtes
Beweismittel ist, weil er entweder getarnt oder durch einen Zeugen vom
Hörensagen (VE-Führer) in die gerichtliche Hauptverhandlung eingeführt
werden muss.
§ 110b Abs. 3 S. 3 StPO). Seine Identität darf auch unter dem Gesichtspunkt
geheimgehalten werden, dass er erneut eingesetzt werden soll ("weitere
Verwendung"). Die polizeirechtlich ausgerichteten Kommentatoren lassen
dabei zu häufig unerwähnt, dass der anonyme VE ein schlechtes
Beweismittel ist, weil er entweder getarnt oder durch einen Zeugen vom
Hörensagen (VE-Führer) in die gerichtliche Hauptverhandlung eingeführt
werden muss.
Die Polizeipraxis folgt dem 1994 entwickelten
Modell von Krey
 (9),
das ich in Kenntnis der aktuellen Rechtsprechung von BGH und BVerfG ablehne.
Das Wort auch bedeutet tatsächlich, dass
das Polizeiverwaltungsrecht den VE extrem restriktiv definiert und
unterhalb davon alle geheimen, aktiven Informationserhebungen als irgend
etwas anderes als den Einsatz eines VE ansieht. (9),
das ich in Kenntnis der aktuellen Rechtsprechung von BGH und BVerfG ablehne.
Das Wort auch bedeutet tatsächlich, dass
das Polizeiverwaltungsrecht den VE extrem restriktiv definiert und
unterhalb davon alle geheimen, aktiven Informationserhebungen als irgend
etwas anderes als den Einsatz eines VE ansieht.
Das findet in dem Leitbild, das der Gesetzgeber
für das Strafverfahrensrecht gesetzt hat, keine Stütze. Es definiert
einen Verdeckten Ermittler, der unmittelbar oberhalb der Schwelle vom
NoeP tätig wird und den Schutz durch Ermittlungsermächtigungen und der
gerichtlichen Genehmigung verdient
 (10). (10).
Daran ändert auch nichts, dass sich die
verdeckten virtuellen Ermittlungen
 durch
mehr Anonymität und Distanz <auszeichnen und> nicht
vergleichbar operativ ausgerichtet sind. Sie sind, wenn sie
längerfristig angelegt sind, aktive Informationserhebungen von
Strafverfolgern, die diese Tatsache nicht offenbaren, und deshalb
verdeckte Ermittlungen im Sinne von durch
mehr Anonymität und Distanz <auszeichnen und> nicht
vergleichbar operativ ausgerichtet sind. Sie sind, wenn sie
längerfristig angelegt sind, aktive Informationserhebungen von
Strafverfolgern, die diese Tatsache nicht offenbaren, und deshalb
verdeckte Ermittlungen im Sinne von
 § 110a StPO. Basta.
§ 110a StPO. Basta.
Das Problem der strafverfahrens- und
polizeirechtlichen Abgrenzungen offenbart sich auch in der Antwort der
Bundesregierung: Es gehe um
 den
Wechsel von der reinen Internetaufklärung, die keinen
Grundrechtseingriff darstellt, hin zu einem Eingriff in das Grundrecht
auf informationelle Selbstbestimmung. Stimmt! den
Wechsel von der reinen Internetaufklärung, die keinen
Grundrechtseingriff darstellt, hin zu einem Eingriff in das Grundrecht
auf informationelle Selbstbestimmung. Stimmt!
|



 |
Fazit |
|
|
 Die LINKEN
fordern mit dem Instrument der Kleinen Anfrage immer wieder Antworten
der Bundesregierung heraus, die einige Brisanz in sich bergen. Das ist
mir nicht das erste Mal aufgefallen, auch wenn ich das hier nicht
vertieft habe, anerkenne aber die Quellenforschung, die dahinter steckt. Die LINKEN
fordern mit dem Instrument der Kleinen Anfrage immer wieder Antworten
der Bundesregierung heraus, die einige Brisanz in sich bergen. Das ist
mir nicht das erste Mal aufgefallen, auch wenn ich das hier nicht
vertieft habe, anerkenne aber die Quellenforschung, die dahinter steckt.
Im Zusammenhang mit den verdeckten Ermittlungen
im Internet offenbaren die Antworten der Bundesregierung mehrere
Probleme, die wirklich in Angriff genommen werden müssen.
 Wegen der Ermittlungen gegen die Internetkriminalität fehlen klare
Bekenntnisse des Gesetzgebers zu den technischen Eingriffsmaßnahmen (Vorratsdaten,
Onlinedurchsuchung, Einsatz technischer Mittel; siehe mein Arbeitspapier).
Das unprofessionelle Schweigen zu diesen Themen widerspricht allen
Regeln, die für das "moderne" Management entwickelt wurden. Danach ist
jeder Nachgesetzte in der Pflicht, alle wichtigen Ereignisse nach "oben"
zu melden, und jeder Vorgesetzte in der Pflicht, seinen Nachgesetzten
alle Informationen und Vorgaben zu geben, die sie zu ihrer
Aufgabenerfüllung brauchen.
Wegen der Ermittlungen gegen die Internetkriminalität fehlen klare
Bekenntnisse des Gesetzgebers zu den technischen Eingriffsmaßnahmen (Vorratsdaten,
Onlinedurchsuchung, Einsatz technischer Mittel; siehe mein Arbeitspapier).
Das unprofessionelle Schweigen zu diesen Themen widerspricht allen
Regeln, die für das "moderne" Management entwickelt wurden. Danach ist
jeder Nachgesetzte in der Pflicht, alle wichtigen Ereignisse nach "oben"
zu melden, und jeder Vorgesetzte in der Pflicht, seinen Nachgesetzten
alle Informationen und Vorgaben zu geben, die sie zu ihrer
Aufgabenerfüllung brauchen.
 Zwischen dem Polizei- und dem Strafverfahrensrecht zum Verdeckten
Ermittler klafft eine Lücke, die vom maßgebenden Strafverfahrensrecht
geschlossen werden muss.
Zwischen dem Polizei- und dem Strafverfahrensrecht zum Verdeckten
Ermittler klafft eine Lücke, die vom maßgebenden Strafverfahrensrecht
geschlossen werden muss.
 Danach ist der NoeP auf klar definierte Ermittlungsaufgaben beschränkt.
Längerfristige Beobachtungen sind dem Verdeckten Ermittler vorbehalten,
der einer staatsanwaltschaftlichen oder gerichtlichen Genehmigung bedarf.
Danach ist der NoeP auf klar definierte Ermittlungsaufgaben beschränkt.
Längerfristige Beobachtungen sind dem Verdeckten Ermittler vorbehalten,
der einer staatsanwaltschaftlichen oder gerichtlichen Genehmigung bedarf.
 Noch
ein schönes Thema, dem ich lange Ausführungen widmen könnte: Das
Leitbild der justiziellen Verfolgung der Internetkriminalität folgt
überwiegend dem Grundsatz, "wasch mich, aber mach' micht nicht nass!". Noch
ein schönes Thema, dem ich lange Ausführungen widmen könnte: Das
Leitbild der justiziellen Verfolgung der Internetkriminalität folgt
überwiegend dem Grundsatz, "wasch mich, aber mach' micht nicht nass!".
In Niedersachsen werden jetzt drei
Zentralstellen für die Verfolgung der Internetkriminalität eingerichtet,
deren Personal aus dem Bestand herausgepuzzelt wird. Begründung: Die zu
bearbeitenden Verfahren sind ja sowieso irgendwo anhängig und werden nur
zusammen geführt. Dass sie auch schon vorher - mehrheitlich - nicht
stringend gefördert wurden, bleibt dem verständnislosen "Ach" geschuldet.
 Den Cyberfahnder zeichnet aus, dass ich hier immer wieder eine
verhaltend positive Perspektive vertreten habe. Wir können, das meine
ich wirklich, auch im vorhandenen Rechtsrahmen die Cybercrime bekämpfen,
wenn wir uns fortbilden, uns auf sie konzentrieren und mit Augenmaß,
dann aber auch ohne falsche Zurückhaltung auf sie eindreschen.
Lippenbekenntnisse ohne fördernde politische Konsequenzen schaffen das
hingegen nicht.
Den Cyberfahnder zeichnet aus, dass ich hier immer wieder eine
verhaltend positive Perspektive vertreten habe. Wir können, das meine
ich wirklich, auch im vorhandenen Rechtsrahmen die Cybercrime bekämpfen,
wenn wir uns fortbilden, uns auf sie konzentrieren und mit Augenmaß,
dann aber auch ohne falsche Zurückhaltung auf sie eindreschen.
Lippenbekenntnisse ohne fördernde politische Konsequenzen schaffen das
hingegen nicht.
 Ja, schon
wieder verbreite ich Pessimismus. Die an Erich Kästner gerichtete Frage,
wo das Positive bliebe, beantworte auch ich wie er: Ja, schon
wieder verbreite ich Pessimismus. Die an Erich Kästner gerichtete Frage,
wo das Positive bliebe, beantworte auch ich wie er:
 Ja, wo
bleibt es denn?
Ja, wo
bleibt es denn?
|



 |
Anmerkungen |
|
|
 (1) (1)

 Kleine Anfrage zur Nutzung sozialer Netzwerke zu Fahndungszwecken,
BT-Drs 17/6100 vom 07.06.2011
Kleine Anfrage zur Nutzung sozialer Netzwerke zu Fahndungszwecken,
BT-Drs 17/6100 vom 07.06.2011
 (2) (2)

 Antwort der Bundesregierung vom 14.07.2011, BT-Drs 17/6587
Antwort der Bundesregierung vom 14.07.2011, BT-Drs 17/6587
 (3) (3)

 Dieter
Kochheim, Verdeckte Ermittlungen im Internet Dieter
Kochheim, Verdeckte Ermittlungen im Internet
 (4) (4)

 LG
Frankfurt am Main, Schriftliche Urteilsgründe in der Strafsache gegen
Wolfgang Daschner, Presseerklärung vom 15.02.2005, S. 29.
LG
Frankfurt am Main, Schriftliche Urteilsgründe in der Strafsache gegen
Wolfgang Daschner, Presseerklärung vom 15.02.2005, S. 29.
 (5) (5)
 verbotene Methoden, 20.04.2008
verbotene Methoden, 20.04.2008
 (6) (6)
 Axel Henrichs, Jörg Wilhelm,
Polizeiliche Ermittlungen in sozialen Netzwerken, Kriminalistik
1/2010
Axel Henrichs, Jörg Wilhelm,
Polizeiliche Ermittlungen in sozialen Netzwerken, Kriminalistik
1/2010
 (7) (7)

 Axel Henrichs, Jörg Wilhelm, Global
vernetzen – lokal ermitteln. Polizeiliche Herausforderungen durch
soziale Netzwerke, Deutsche Polizei (GdP) 10/2010, S. 6.
Axel Henrichs, Jörg Wilhelm, Global
vernetzen – lokal ermitteln. Polizeiliche Herausforderungen durch
soziale Netzwerke, Deutsche Polizei (GdP) 10/2010, S. 6.
 (8) (8)

 BVerfG, Urteil vom 27.02.2008 - 1 BvR 370/07, 595/07
BVerfG, Urteil vom 27.02.2008 - 1 BvR 370/07, 595/07
 (9) (9)

 Volker Krey, Rechtsprobleme des Einsatzes qualifizierter Scheinaufkäufer
im Strafverfahrensrecht, ZKA Köln 1994
Volker Krey, Rechtsprobleme des Einsatzes qualifizierter Scheinaufkäufer
im Strafverfahrensrecht, ZKA Köln 1994
 (10) (10)

 BGH, Urteil vom 22.012.1995 – 3 StR 552/94
BGH, Urteil vom 22.012.1995 – 3 StR 552/94
|



 |
Cyberfahnder |
|
© Dieter Kochheim,
11.03.2018 |