|
|
Auswirkungen auf das
Skimming-Strafrecht |
|
 Der Täter handelt nicht gewerbsmäßig im Sinne des
Der Täter handelt nicht gewerbsmäßig im Sinne des
 § 146 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 2 StGB, wenn er sich eine
Falschgeldmenge in einem Akt verschafft hat und diese Menge dann
plangemäß in mehreren Teilakten in Verkehr bringt.
§ 146 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 2 StGB, wenn er sich eine
Falschgeldmenge in einem Akt verschafft hat und diese Menge dann
plangemäß in mehreren Teilakten in Verkehr bringt.
 (1)
<Leitsatz> (1)
<Leitsatz> |
|
11-03-21
 Mit der
Beschränkung des Qualifikationsmerkmals "Gewerbsmäßigkeit" hat der BGH
vor allem das Fälschungsstrafrecht mit dem BtM-Strafrecht harmonisiert Mit der
Beschränkung des Qualifikationsmerkmals "Gewerbsmäßigkeit" hat der BGH
vor allem das Fälschungsstrafrecht mit dem BtM-Strafrecht harmonisiert
 (1).
Die Auswirkungen auf das Skimmingrecht sind nur gering. (1).
Die Auswirkungen auf das Skimmingrecht sind nur gering.

 Gewerbsmäßig handelt, wer sich durch wiederholte Tatbegehung eine
nicht nur vorübergehende Einnahmequelle von einigem Umfang und einiger
Dauer verschaffen will. Liegt diese Absicht vor, ist bereits die erste
Tat als gewerbsmäßig begangen einzustufen, auch wenn es entgegen den
ursprünglichen Intentionen des Täters zu weiteren Taten nicht kommt.
Eine Verurteilung wegen gewerbsmäßiger Deliktsbegehung setzt daher schon
im Grundsatz nicht notwendig voraus, dass der Täter zur Gewinnerzielung
mehrere selbständige Einzeltaten der jeweils in Rede stehenden Art
verwirklicht hat
Gewerbsmäßig handelt, wer sich durch wiederholte Tatbegehung eine
nicht nur vorübergehende Einnahmequelle von einigem Umfang und einiger
Dauer verschaffen will. Liegt diese Absicht vor, ist bereits die erste
Tat als gewerbsmäßig begangen einzustufen, auch wenn es entgegen den
ursprünglichen Intentionen des Täters zu weiteren Taten nicht kommt.
Eine Verurteilung wegen gewerbsmäßiger Deliktsbegehung setzt daher schon
im Grundsatz nicht notwendig voraus, dass der Täter zur Gewinnerzielung
mehrere selbständige Einzeltaten der jeweils in Rede stehenden Art
verwirklicht hat
 (2). (2).
 Zur
Erklärung muss zunächst die deliktische Einheit angesprochen werden ( Zur
Erklärung muss zunächst die deliktische Einheit angesprochen werden ( § 52 StGB).
§ 52 StGB).
Wegen der mehraktigen Tatbegehung
 (3) hat der BGH im BtM-Strafrecht schon lange den
Grundsatz der Bewertungseinheit eingeführt (3) hat der BGH im BtM-Strafrecht schon lange den
Grundsatz der Bewertungseinheit eingeführt
 (4),
den er auf das Fälschungsstrafrecht übertragen hat (4),
den er auf das Fälschungsstrafrecht übertragen hat
 (5)
und häufiger auch eine "deliktische Einheit" nennt (5)
und häufiger auch eine "deliktische Einheit" nennt
 (6).
Dadurch werden alle Tathandlungen, die für sich genommen jeweils eine
Strafnorm vollenden, zu einer materiellen Tat zusammengefasst, wenn es
sich um dasselbe Strafgesetz handelt und die einzelnen Handlungsakte in
einem engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen. (6).
Dadurch werden alle Tathandlungen, die für sich genommen jeweils eine
Strafnorm vollenden, zu einer materiellen Tat zusammengefasst, wenn es
sich um dasselbe Strafgesetz handelt und die einzelnen Handlungsakte in
einem engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen.
 Für das Skimmingstrafrecht bedeutet das, dass
Für das Skimmingstrafrecht bedeutet das, dass
 serienmäßige Fälschungen von Zahlungskarten (Grundtatbestände der
serienmäßige Fälschungen von Zahlungskarten (Grundtatbestände der
 §§ 152a,
§§ 152a,
 152b StGB),
152b StGB),
|
 das Sich-Verschaffen mehrerer gefälschter Zahlungskarten,
das Sich-Verschaffen mehrerer gefälschter Zahlungskarten,
 das serienmäßige Gebrauchen gefälschter Zahlungskarten (Cashing) und
das serienmäßige Gebrauchen gefälschter Zahlungskarten (Cashing) und
 das serienmäßige Fälschen von Zahlungskarten und ihr unmittelbar
anschließender, auch serienmäßiger Gebrauch
das serienmäßige Fälschen von Zahlungskarten und ihr unmittelbar
anschließender, auch serienmäßiger Gebrauch
eine deliktische Einheit darstellen, die zur Verurteilung wegen nur
einer materiellen Tat führen. Voraussetzung ist, dass keine bedeutsamen
zeitlichen Lücken erkennbar sind, die wegen der Folgehandlungen einen
neuen Tatentschluss nötig machen würden.
 Ausschlaggebend sind die Vorstellungen der beteiligten Täter von der Tat
als Ganzes und in arbeitsteiligen Tätergruppen der Vorsatz des einzelnen
Täters über seinen eigenen Tatanteil und den Handlungen der Tatgenossen
Ausschlaggebend sind die Vorstellungen der beteiligten Täter von der Tat
als Ganzes und in arbeitsteiligen Tätergruppen der Vorsatz des einzelnen
Täters über seinen eigenen Tatanteil und den Handlungen der Tatgenossen
 (7). (7).
 Das gilt
ebenso für die mehraktigen Handlungen. Im BtM-Strafrecht ging es vor
allem um die Frage, wie ein Täter zu behandeln ist, der sich zunächst
eine nicht geringe Menge Rauschgift als Ganzes beschafft und besitzt
(Verbrechen gemäß Das gilt
ebenso für die mehraktigen Handlungen. Im BtM-Strafrecht ging es vor
allem um die Frage, wie ein Täter zu behandeln ist, der sich zunächst
eine nicht geringe Menge Rauschgift als Ganzes beschafft und besitzt
(Verbrechen gemäß
 § 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG) und dann seinem Plan folgend in Kleinmengen
einzeln verkauft (jeweils für sich ein Vergehen gemäß
§ 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG) und dann seinem Plan folgend in Kleinmengen
einzeln verkauft (jeweils für sich ein Vergehen gemäß
 29 Abs. 1 Nr. 1 BtMG). Der BGH spricht insoweit von "demselben
Verkaufsvorrat" und "derselben Erwerbsmenge"
29 Abs. 1 Nr. 1 BtMG). Der BGH spricht insoweit von "demselben
Verkaufsvorrat" und "derselben Erwerbsmenge"
 (8)
und zieht alle Handlungen des Erwerbs und der Veräußerung zu einer
materiellen Tat zusammen, wenn sie aus demselben Depot stammen. (8)
und zieht alle Handlungen des Erwerbs und der Veräußerung zu einer
materiellen Tat zusammen, wenn sie aus demselben Depot stammen.
|



 |
deliktische Einheit bei der Geldfälschung |
Gewerbsmäßigkeit bei mehraktigem Absatz |
|
|
 Diese
Grundsätze hat der BGH - etwas versteckt, aber unter ausdrücklicher
Bezugnahme auf seine BtM-Rechtsprechung - auf das Falschgeldrecht
übertragen Diese
Grundsätze hat der BGH - etwas versteckt, aber unter ausdrücklicher
Bezugnahme auf seine BtM-Rechtsprechung - auf das Falschgeldrecht
übertragen
 (9).
Danach gilt für das Falschgeld-Depot dasselbe wie für den
Rauschgift-Bunker: Wenn das Falschgeld aus der derselben Beschaffungstat
stammt (Verbrechen des Beschaffens gemäß (9).
Danach gilt für das Falschgeld-Depot dasselbe wie für den
Rauschgift-Bunker: Wenn das Falschgeld aus der derselben Beschaffungstat
stammt (Verbrechen des Beschaffens gemäß
 § 146 Abs. 1 Nr. 2 StGB) und dann seinem Plan folgend nach und nach
von ihm in den Verkehr gebracht wird (Verbrechen des als echt in Verkehr
bringen gemäß
§ 146 Abs. 1 Nr. 2 StGB) und dann seinem Plan folgend nach und nach
von ihm in den Verkehr gebracht wird (Verbrechen des als echt in Verkehr
bringen gemäß
 § 146 Abs. 1 Nr. 3 StGB), dann handelt es sich insgesamt um eine
materielle Tat.
§ 146 Abs. 1 Nr. 3 StGB), dann handelt es sich insgesamt um eine
materielle Tat.
 Es muss
sich aber um ein nur einmal gefülltes Depot handeln. Es muss
sich aber um ein nur einmal gefülltes Depot handeln.
 Wird eine zum Verkauf bereitgehaltene Rauschgiftmenge vor der
vollständigen Entleerung des Depots durch eine neue Lieferung wieder
aufgefüllt, so reicht das nicht aus, die Veräußerungen aus der
ursprünglich besessenen Menge mit den Verkäufen aus dem
wiederaufgefüllten Bestand zu einem einheitlichen Handeltreiben mit
derselben Rauschgiftmenge zu verbinden
Wird eine zum Verkauf bereitgehaltene Rauschgiftmenge vor der
vollständigen Entleerung des Depots durch eine neue Lieferung wieder
aufgefüllt, so reicht das nicht aus, die Veräußerungen aus der
ursprünglich besessenen Menge mit den Verkäufen aus dem
wiederaufgefüllten Bestand zu einem einheitlichen Handeltreiben mit
derselben Rauschgiftmenge zu verbinden
 (10). (10).
Damit verlangt der BGH sehr viel von der Rechtsprechung: Sie muss
einem einzelnen Erwerbsgeschäft alle "kleinen" Vertriebsgeschäfte
zuordnen, die dieselbe Erwerbsmenge betreffen. Mehrere Füllungen führen
für sich zu einer weiteren materiellen Tat. Bleiben nach dem
Auffüllen des Depots Zweifel an der Zuordnung, so ist die Veräußerung
der ersten "Füllmenge" zuzurechnen
 (11). (11).
|
 Ganz
ähnliche Probleme stellen sich wegen des Qualifizierungsmerkmals des
gewerbsmäßigen Handelns, das Mal als ein besonders schwerer Fall des
Grunddelikts ausgebildet ist (zum Beispiel beim Betrug: Ganz
ähnliche Probleme stellen sich wegen des Qualifizierungsmerkmals des
gewerbsmäßigen Handelns, das Mal als ein besonders schwerer Fall des
Grunddelikts ausgebildet ist (zum Beispiel beim Betrug:
 §§ 263 Abs. 3 Nr. 1,
§§ 263 Abs. 3 Nr. 1,
 12
Abs. 3 StGB) und häufig zu einem qualifizierten, selbständigen
Tatbestand wird (Skimming: 12
Abs. 3 StGB) und häufig zu einem qualifizierten, selbständigen
Tatbestand wird (Skimming:
 §§ 152a Abs. 3,
§§ 152a Abs. 3,
 152b Abs. 2 StGB).
152b Abs. 2 StGB).
Die
 oben zitierte Definition für die Gewerbsmäßigkeit verlangt einen
Täterwillen, der auf Dauer und Wiederholung der gleichen Tat ausgerichtet
ist. Für das Falschgeldrecht legt der BGH jetzt fest, dass die
planmäßigen Absatzgeschäfte jedenfalls für sich nicht die Wiederholung
derselben Tat begründen, wenn das Falschgeld aus demselben Beschaffungsdelikt
stammt.
oben zitierte Definition für die Gewerbsmäßigkeit verlangt einen
Täterwillen, der auf Dauer und Wiederholung der gleichen Tat ausgerichtet
ist. Für das Falschgeldrecht legt der BGH jetzt fest, dass die
planmäßigen Absatzgeschäfte jedenfalls für sich nicht die Wiederholung
derselben Tat begründen, wenn das Falschgeld aus demselben Beschaffungsdelikt
stammt.
Mit anderen Worten: Die Absatzgeschäfte, die der Täter bereits bei
dem Verschaffen einer größeren Menge Falschgeld plant, sind als
Absatzhandlungen mit der Beschaffungstat zu einer einzigen materiellen
Tat zusammen zu fassen. Allein aus dem von vornherein geplanten
"Straßenverkauf" - hier: Absatz von Falschgeld - lässt sich noch kein
Willen zur Wiederholung im Sinne der Gewerbsmäßigkeit ableiten. Dieser
Wille muss weiter gehen und weitere Beschaffungshandlungen in Aussicht
stellen.
Das führt nicht etwa dazu, dass die Gewerbsmäßigkeit bei ersten Taten
völlig ausgeschlossen wäre. Der BGH verlangt nur nach einer genauen
Betrachtung des Täterwillens und der Feststellung, dass er von
vornherein die Wiederholung der Beschaffungstat einschließlich der
verbundenen Absatztaten plante. Von indizieller Bedeutung kann dafür
auch die Schaffung des Depots und das von Erfahrung und Planung geprägte
Vorgehen des Täters sein.
|



 |
Auswirkungen auf das Skimming-Strafrecht |
|
|
 Die
ausgeführten Grundsätze zur deliktischen Einheit, zur Bildung von Depots
und zur Gewerbsmäßigkeit müssen aus zwei Gründen auch auf das Skimming-Strafrecht
übertragen werden: Es gehört ausdrücklich zum Fälschungsstrafrecht, weil
der Gesetzgeber das Geld, die Wertpapiere und die Zahlungskarten
einheitlich betrachtet, und dem Harmonisierungsstreben des BGH muss
Rechnung getragen werden. Besonderheiten im strafrechtlichen Gegenstand
können deshalb nur dann abgeleitet werden, wenn die Tatbestände echte
Unterschiede aufweisen oder das Tatverhalten nicht vergleichbar ist. Die
ausgeführten Grundsätze zur deliktischen Einheit, zur Bildung von Depots
und zur Gewerbsmäßigkeit müssen aus zwei Gründen auch auf das Skimming-Strafrecht
übertragen werden: Es gehört ausdrücklich zum Fälschungsstrafrecht, weil
der Gesetzgeber das Geld, die Wertpapiere und die Zahlungskarten
einheitlich betrachtet, und dem Harmonisierungsstreben des BGH muss
Rechnung getragen werden. Besonderheiten im strafrechtlichen Gegenstand
können deshalb nur dann abgeleitet werden, wenn die Tatbestände echte
Unterschiede aufweisen oder das Tatverhalten nicht vergleichbar ist.
 Das
Skimming in seiner jetzt bekannten Form kennt keine Depots. Den
arbeitsteilig handelnden Tätern kommt es auf Schnelligkeit an, um den
Kartensperren der Finanzinstitute zuvor zu kommen. Noch im
Vorbereitungsstadium ist das Skimming im engeren Sinne angesiedelt, also
das Ausspähen der Kartendaten auf den Magnetstreifen und der PIN des
betroffenen Karteninhabers. Unverzüglich nach dem Abbau der Skimming-Geräte
werden in aller Regel die Daten zu den Hinterleuten oder direkt an die
Casher übermittelt Das
Skimming in seiner jetzt bekannten Form kennt keine Depots. Den
arbeitsteilig handelnden Tätern kommt es auf Schnelligkeit an, um den
Kartensperren der Finanzinstitute zuvor zu kommen. Noch im
Vorbereitungsstadium ist das Skimming im engeren Sinne angesiedelt, also
das Ausspähen der Kartendaten auf den Magnetstreifen und der PIN des
betroffenen Karteninhabers. Unverzüglich nach dem Abbau der Skimming-Geräte
werden in aller Regel die Daten zu den Hinterleuten oder direkt an die
Casher übermittelt
 (12).
Manchmal setzen die Skimmer dann ihren Angriff fort, während die
Mittäter mit der ersten Tranche Zahlungskarten fälschen und damit
die Tat vollenden. Zwischen dem Ausspähen und dem Cashing, also dem
Gebrauch der gefälschten Zahlungskarten, vergeht häufig nur ein einziger
Tag. (12).
Manchmal setzen die Skimmer dann ihren Angriff fort, während die
Mittäter mit der ersten Tranche Zahlungskarten fälschen und damit
die Tat vollenden. Zwischen dem Ausspähen und dem Cashing, also dem
Gebrauch der gefälschten Zahlungskarten, vergeht häufig nur ein einziger
Tag.
 Das
unterscheidet das Skimming deutlich vom Falschgeld- und BtM-Handel. Es
kennt keinen mühseligen Straßenverkauf, sondern nur den schnellen großen
Schlag, um bis zur Entdeckung des Angriffs und den Kontensperren
möglichst viel Beute zu machen. Das
unterscheidet das Skimming deutlich vom Falschgeld- und BtM-Handel. Es
kennt keinen mühseligen Straßenverkauf, sondern nur den schnellen großen
Schlag, um bis zur Entdeckung des Angriffs und den Kontensperren
möglichst viel Beute zu machen.
|
 Probleme
wegen der deliktischen Einheit können aber dann auftreten, wenn beim
Fälschen oder beim Cashing verschiedenen Quellen von ausgespähten Daten
zusammen kommen. Zu betrachten ist dabei das Grunddelikt, also das
Fälschen von Zahlungskarten, das in der Strafverfolgungspraxis häufig
konturenlos bleibt. Es findet in aller Regel im Ausland statt. Die
Fälscher selber bleiben meist unbekannt. Je weiter räumlich entfernt von
den gemeinsamen Hinterleuten die Casher handeln, desto eher lässt sich
annehmen, dass sie die Fälschungen mit den elektronisch übermittelten
Daten der Skimmer selber ausführen. Probleme
wegen der deliktischen Einheit können aber dann auftreten, wenn beim
Fälschen oder beim Cashing verschiedenen Quellen von ausgespähten Daten
zusammen kommen. Zu betrachten ist dabei das Grunddelikt, also das
Fälschen von Zahlungskarten, das in der Strafverfolgungspraxis häufig
konturenlos bleibt. Es findet in aller Regel im Ausland statt. Die
Fälscher selber bleiben meist unbekannt. Je weiter räumlich entfernt von
den gemeinsamen Hinterleuten die Casher handeln, desto eher lässt sich
annehmen, dass sie die Fälschungen mit den elektronisch übermittelten
Daten der Skimmer selber ausführen.
 Anders als
beim Rauschgift und beim Falschgeld, die in aller Regel keine
eindeutigen Individualmerkmale zeigen Anders als
beim Rauschgift und beim Falschgeld, die in aller Regel keine
eindeutigen Individualmerkmale zeigen
 (13),
sind die beim Skimming ausgespähten Daten sehr genau einem räumlich und
zeitlich eingegrenzten Angriff und individuell eindeutig bestimmten
Geschädigten zuzuordnen. Die Tatvollendung ist den Skimmern
("Ausspähern") zunächst nur wegen der von ihnen selber ausgespähten
Daten zuzurechnen. Wissen sie von weiteren Skimmer-Gruppen, die zu ihnen
parallel arbeiten, dann können ihnen auch deren Tatanteile zugerechnet
werden (13),
sind die beim Skimming ausgespähten Daten sehr genau einem räumlich und
zeitlich eingegrenzten Angriff und individuell eindeutig bestimmten
Geschädigten zuzuordnen. Die Tatvollendung ist den Skimmern
("Ausspähern") zunächst nur wegen der von ihnen selber ausgespähten
Daten zuzurechnen. Wissen sie von weiteren Skimmer-Gruppen, die zu ihnen
parallel arbeiten, dann können ihnen auch deren Tatanteile zugerechnet
werden
 (14). (14).
 Die Frage
nach den Depots stellt sich eher beim Carding im übrigen, also beim
Handel mit ausgespähten Karten-, Konto- und sonstigen persönlichen Daten
in Carding-Boards. Sie werden in aller Regel einzeln missbraucht, aber
häufiger in mehreren "Stücken" verkauft Die Frage
nach den Depots stellt sich eher beim Carding im übrigen, also beim
Handel mit ausgespähten Karten-, Konto- und sonstigen persönlichen Daten
in Carding-Boards. Sie werden in aller Regel einzeln missbraucht, aber
häufiger in mehreren "Stücken" verkauft
 (15).
Sowohl beim Datenverkäufer als Beihilfetäter zum Computerbetrug als auch
beim Käufer stellt sich dann schon die Frage nach der Qualität und des
Umfangs des (für sich straflosen) Hehlergeschäftes. (15).
Sowohl beim Datenverkäufer als Beihilfetäter zum Computerbetrug als auch
beim Käufer stellt sich dann schon die Frage nach der Qualität und des
Umfangs des (für sich straflosen) Hehlergeschäftes.
|



 |
Gewerbsmäßigkeit beim Skimming |
Skimming: aktuelles Beteiligungsmodell |
|
|
 Mit der
einschränkenden Rechtsprechung zur Gewerbsmäßigkeit bei den sukzessiven
Absatzhandlungen kann man jedenfalls aus der Tatsache des Cashings über
mehrere Tage oder (früher) über mehrere Wochen hinweg keine
Gewerbsmäßigkeit ableiten. Das ist in der Praxis auch nie ein Problem
gewesen. Mit der
einschränkenden Rechtsprechung zur Gewerbsmäßigkeit bei den sukzessiven
Absatzhandlungen kann man jedenfalls aus der Tatsache des Cashings über
mehrere Tage oder (früher) über mehrere Wochen hinweg keine
Gewerbsmäßigkeit ableiten. Das ist in der Praxis auch nie ein Problem
gewesen.
Andere Merkmale sprechen in aller Regel für die Gewerbsmäßigkeit. Das
sind vor allem das erfahrene, handwerklich geübte und versierte Vorgehen
der Täter, ihre engen Kommunikationsbeziehungen, die schnelle Weitergabe
der ausgespähten Daten und der unverzügliche Beginn des Cashings. Die
Skimmer setzen zudem vorgefertigtes Gerät ein, das für den nur
einmaligen Einsatz viel zu teuer und zu wertvoll ist. Häufig genug
fallen die Täter auch mehrmals auf, so dass auch dieser Umstand Schlüsse
eröffnet.
 Die breite
Erörterung der deliktischen Einheit war nötig, weil ohne sie die
Entscheidung des BGH zur Gewerbsmäßigkeit nicht erfasst werden kann. In
beiden Fallgruppen geht es um die Beurteilung mehraktiger Taten, die
jedenfalls in arbeitsteiligen Täterstrukturen eine genaue Betrachtung
der individuellen Tatanteile und des persönlichen Vorsatzes nötig macht. Die breite
Erörterung der deliktischen Einheit war nötig, weil ohne sie die
Entscheidung des BGH zur Gewerbsmäßigkeit nicht erfasst werden kann. In
beiden Fallgruppen geht es um die Beurteilung mehraktiger Taten, die
jedenfalls in arbeitsteiligen Täterstrukturen eine genaue Betrachtung
der individuellen Tatanteile und des persönlichen Vorsatzes nötig macht.
Die Auseinandersetzung mit ihnen zeigt aber, dass keine
grundsätzlichen Weichenstellungen im Skimming-Strafrecht erforderlich
geworden sind. Es sind nur Einzelheiten, die im Lichte der aktuellen
Rechtsprechung genauer betrachtet werden müssen. Im Ergebnis profitiert
das Skimming-Strafrecht davon: Es ist nach wie vor schwierig und reich
an Einzelaspekten, aber präziser in Bezug auf die Mehraktigkeit und
Arbeitsteilung geworden.
|
 Das
Beteiligungsmodell, das ich im Sommer 2010 entwickelt habe Das
Beteiligungsmodell, das ich im Sommer 2010 entwickelt habe
 (16),
bekommt durch die aktuelle Rechtsprechung genauere Konturen (siehe
Grafik (16),
bekommt durch die aktuelle Rechtsprechung genauere Konturen (siehe
Grafik  unten).
unten).
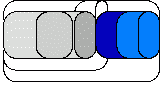  Das Grunddelikt ist das Fälschen von Zahlungskarten im Sinne der
Das Grunddelikt ist das Fälschen von Zahlungskarten im Sinne der
 §§ 152a,
§§ 152a,
 152b StGB (dunkelblau). Gleichrangige (aber nachfolgende)
Tathandlungen sind das Sich-Verschaffen und das Gebrauchen von
falschen Zahlungskarten (marineblau).
152b StGB (dunkelblau). Gleichrangige (aber nachfolgende)
Tathandlungen sind das Sich-Verschaffen und das Gebrauchen von
falschen Zahlungskarten (marineblau).
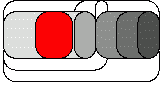 Das
Skimming im engeren Sinne, also das Ausspähen der Kartendaten und PIN
(rot), ist im Vorbereitungsstadium des Fälschungsdelikts angesiedelt. Es
ist kein Erfolgsdelikt, also vor allem kein Ausspähen von Daten im Sinne
von Das
Skimming im engeren Sinne, also das Ausspähen der Kartendaten und PIN
(rot), ist im Vorbereitungsstadium des Fälschungsdelikts angesiedelt. Es
ist kein Erfolgsdelikt, also vor allem kein Ausspähen von Daten im Sinne
von
 § 202a StGB
§ 202a StGB
 (17). (17).
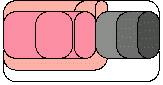 Das
Vorbereitungsstadium beim Skimming reicht von der Herstellung von
Skimmern (Kartenlesegeräten), über ihren Einsatz (Skimming im engeren
Sinne) bis zum Beginn der Fälschung von Zahlungskarten. Strafrechtlich
wird es erfasst vom Vorbereiten der Fälschung von Zahlungskarten ( Das
Vorbereitungsstadium beim Skimming reicht von der Herstellung von
Skimmern (Kartenlesegeräten), über ihren Einsatz (Skimming im engeren
Sinne) bis zum Beginn der Fälschung von Zahlungskarten. Strafrechtlich
wird es erfasst vom Vorbereiten der Fälschung von Zahlungskarten ( § 149 Abs. 1 Nr. 1 StGB) und der Verabredung zu einem Verbrechen (
§ 149 Abs. 1 Nr. 1 StGB) und der Verabredung zu einem Verbrechen ( § 30 Abs. 2 StGB), an der sich aber nur Mittäter (
§ 30 Abs. 2 StGB), an der sich aber nur Mittäter ( § 25 Abs. 2 StGB), nicht aber auch Gehilfen beteiligen können (
§ 25 Abs. 2 StGB), nicht aber auch Gehilfen beteiligen können ( § 27 Abs. 1 StGB).
§ 27 Abs. 1 StGB).
|



 |
Anmerkungen |
|
|
 (1) (1)

 BGH, Beschluss vom 02.02.2011 - 2 StR 511/10
BGH, Beschluss vom 02.02.2011 - 2 StR 511/10
 (2)
Ebenda (2)
Ebenda
 (1), Rn 9.
(1), Rn 9.
 (3) (3)
 Mittäterschaft und strafrechtliche Haftung, 25.12.2009;
Mittäterschaft und strafrechtliche Haftung, 25.12.2009;
 materielle und prozessuale Tat, 13.05.2010;
materielle und prozessuale Tat, 13.05.2010;
 Klammerwirkung bei Dauerdelikten, 23.12.2010;
Klammerwirkung bei Dauerdelikten, 23.12.2010;
 Vorbereitung und Versuch beim Betrug, 08.02.2011.
Vorbereitung und Versuch beim Betrug, 08.02.2011.
 (4) (4)
 materielle und prozessuale Tat, 13.05.2010
materielle und prozessuale Tat, 13.05.2010
 (5) (5)
 Kreditkartenbetrug, 23.10.2010
Kreditkartenbetrug, 23.10.2010
 (6)
Nachweise im (6)
Nachweise im
 Arbeitspapier
Skimming, 2.4 natürliche Handlungseinheiten <S.
17>. Arbeitspapier
Skimming, 2.4 natürliche Handlungseinheiten <S.
17>.
 (7)
Klarstellend: (7)
Klarstellend:
 Tatanteile des Mittäters, 16.02.2011.
Tatanteile des Mittäters, 16.02.2011.
 (8) (8)


 BGH, Beschluss vom 19.12.2000 - 4 StR 503/00,
hrr-strafrecht.de
BGH, Beschluss vom 19.12.2000 - 4 StR 503/00,
hrr-strafrecht.de
 (9) (9)

 BGH, Beschluss vom 20.09.2010 - 4 StR 408/10, Rn 5;
BGH, Beschluss vom 20.09.2010 - 4 StR 408/10, Rn 5;
unter Verweis auf:

 BGH, Urteil vom 30.07.2009 - 3 StR 273/09.
BGH, Urteil vom 30.07.2009 - 3 StR 273/09.
 (10) (10)

 BGH, Beschluss vom 26.05.2000 - 3 StR 162/00, Rn
10, hrr-strafrecht.de
BGH, Beschluss vom 26.05.2000 - 3 StR 162/00, Rn
10, hrr-strafrecht.de
 (11)
Ebenda (11)
Ebenda
 (10), Rn 11.
(10), Rn 11.
|
 (12)
So auch in dem Fall, der den BGH dazu veranlasst hat, in arbeitsteiligen
Tätergruppen bereits mit der Übermittlung der Daten den Versuch beginnen
zu lassen: (12)
So auch in dem Fall, der den BGH dazu veranlasst hat, in arbeitsteiligen
Tätergruppen bereits mit der Übermittlung der Daten den Versuch beginnen
zu lassen:
 Versuch der Fälschung, 21.02.2011.
Versuch der Fälschung, 21.02.2011.
 (13)
Falschgeld lässt sich nach Qualitätsmerkmalen und den Merkmalen der
verwendeten Platten, Formen, Drucksätze und Druckstöcke unterscheiden.
Auch Rauschgift zeigt chemische Individualmerkmale aufgrund seiner
Herkunft und der Mischung mit Streckmitteln. (13)
Falschgeld lässt sich nach Qualitätsmerkmalen und den Merkmalen der
verwendeten Platten, Formen, Drucksätze und Druckstöcke unterscheiden.
Auch Rauschgift zeigt chemische Individualmerkmale aufgrund seiner
Herkunft und der Mischung mit Streckmitteln.
 (14)
Diese Aussage findet ihre Stütze in der neuen Schadens-Rechtsprechung
des BGH ( (14)
Diese Aussage findet ihre Stütze in der neuen Schadens-Rechtsprechung
des BGH ( Der Eingehungsschaden löst den Gefährdungsschaden ab, 16.02.2011).
Der eigene Tatbeitrag ist den Skimmern wie beim Eingehungsschaden und
die Tatbeiträge der anderen Skimmer als Folgeschaden, also wie als
"weitergehende Vermögensnachteile" zuzurechnen.
Der Eingehungsschaden löst den Gefährdungsschaden ab, 16.02.2011).
Der eigene Tatbeitrag ist den Skimmern wie beim Eingehungsschaden und
die Tatbeiträge der anderen Skimmer als Folgeschaden, also wie als
"weitergehende Vermögensnachteile" zuzurechnen.
 (15)
Die Szenesprache ist insoweit uneinheitlich. Ein "Dump" ist ein
zusammengehörender "Haufen". Das können individuelle Datensätze ebenso
sein wie der Inhalt einer ganzen Datenbank. (15)
Die Szenesprache ist insoweit uneinheitlich. Ein "Dump" ist ein
zusammengehörender "Haufen". Das können individuelle Datensätze ebenso
sein wie der Inhalt einer ganzen Datenbank.
 (16) (16)
 Bilderbuch Skimming-Strafrecht, 26.07.2010
Bilderbuch Skimming-Strafrecht, 26.07.2010
 (17) (17)
 Ausspähen von Daten und das Skimming, 14.05.2010
Ausspähen von Daten und das Skimming, 14.05.2010
 (18) (18)
 Versuch der Fälschung, 21.02.2011
Versuch der Fälschung, 21.02.2011
|



 |
Cyberfahnder |
|
© Dieter Kochheim,
11.03.2018 |

